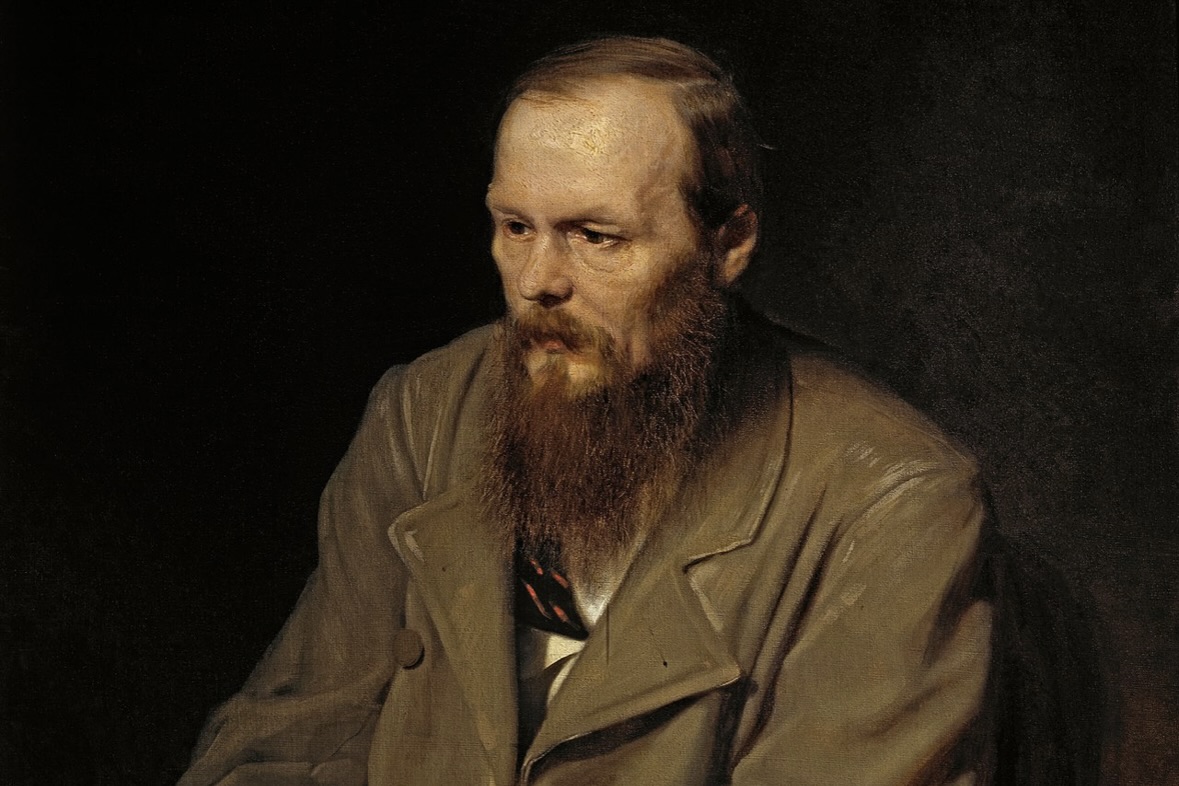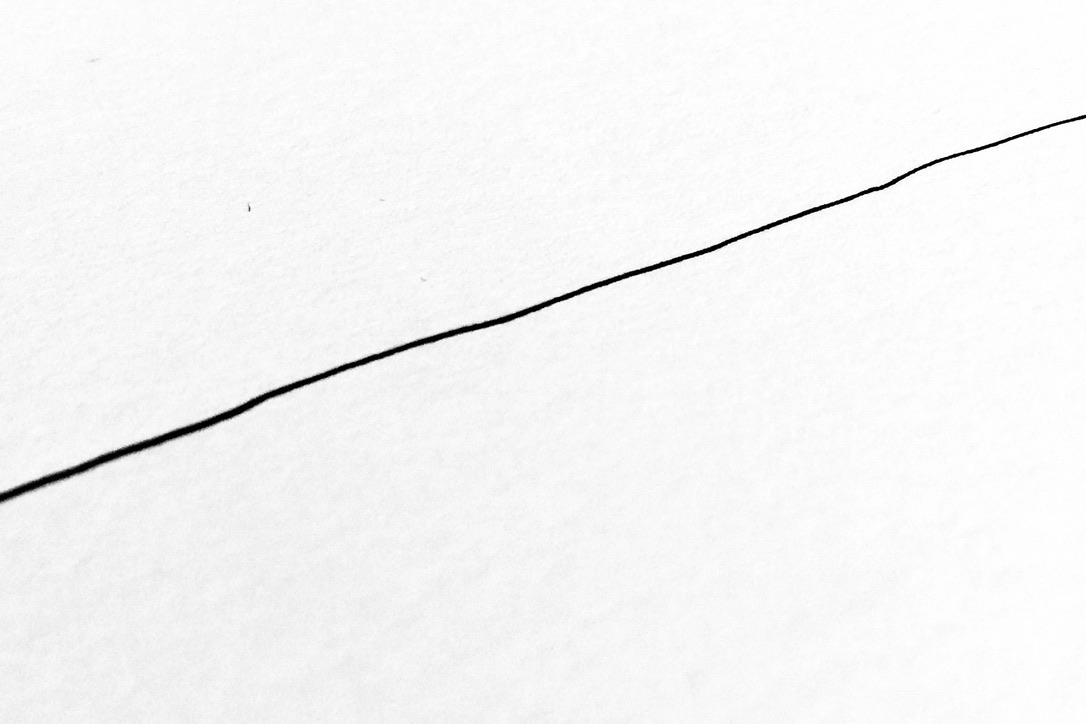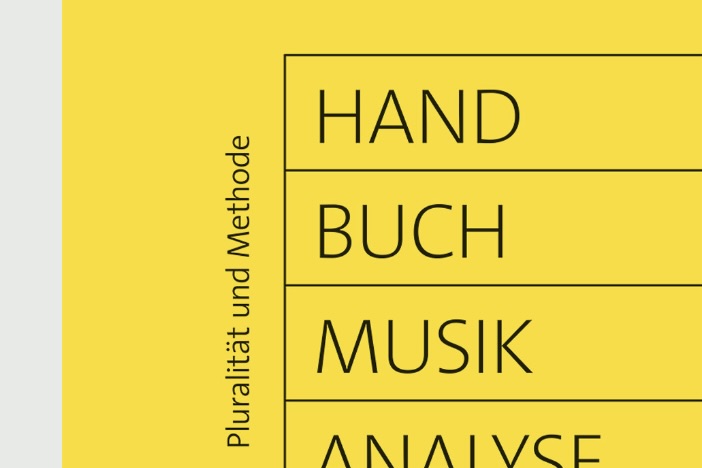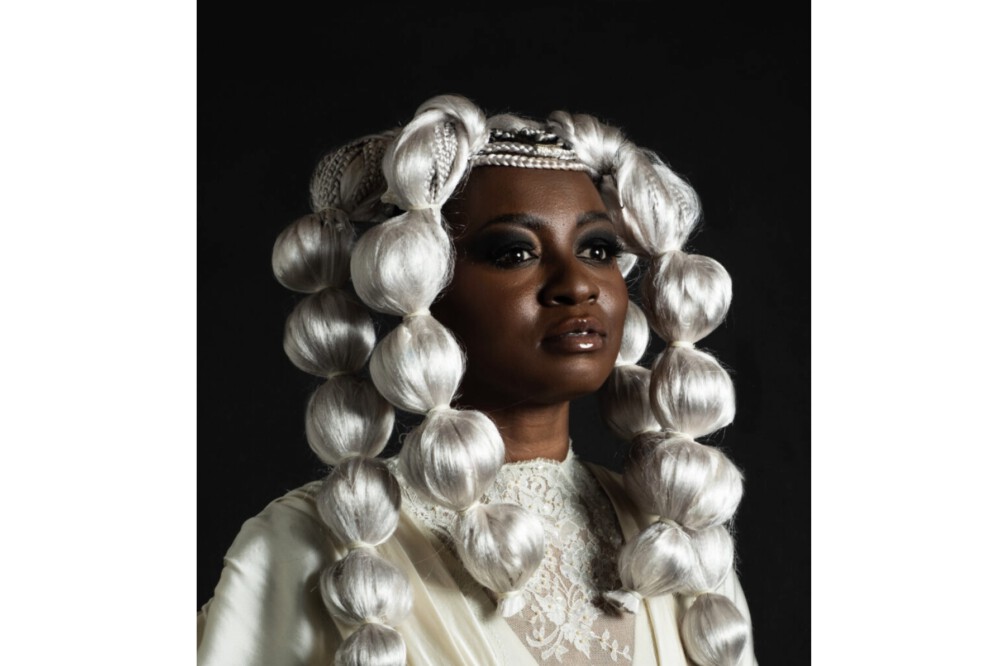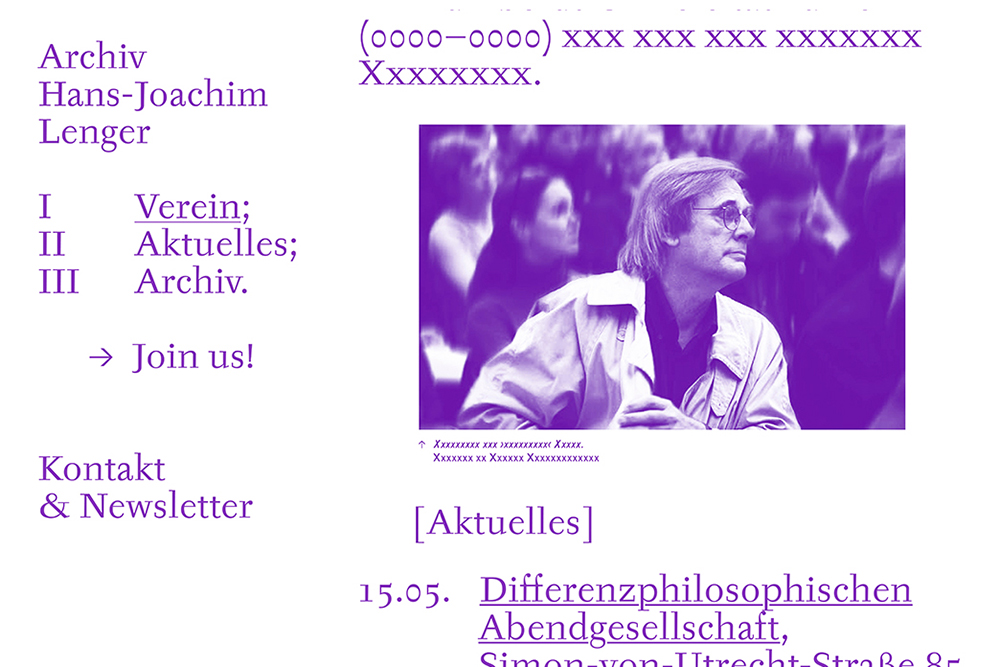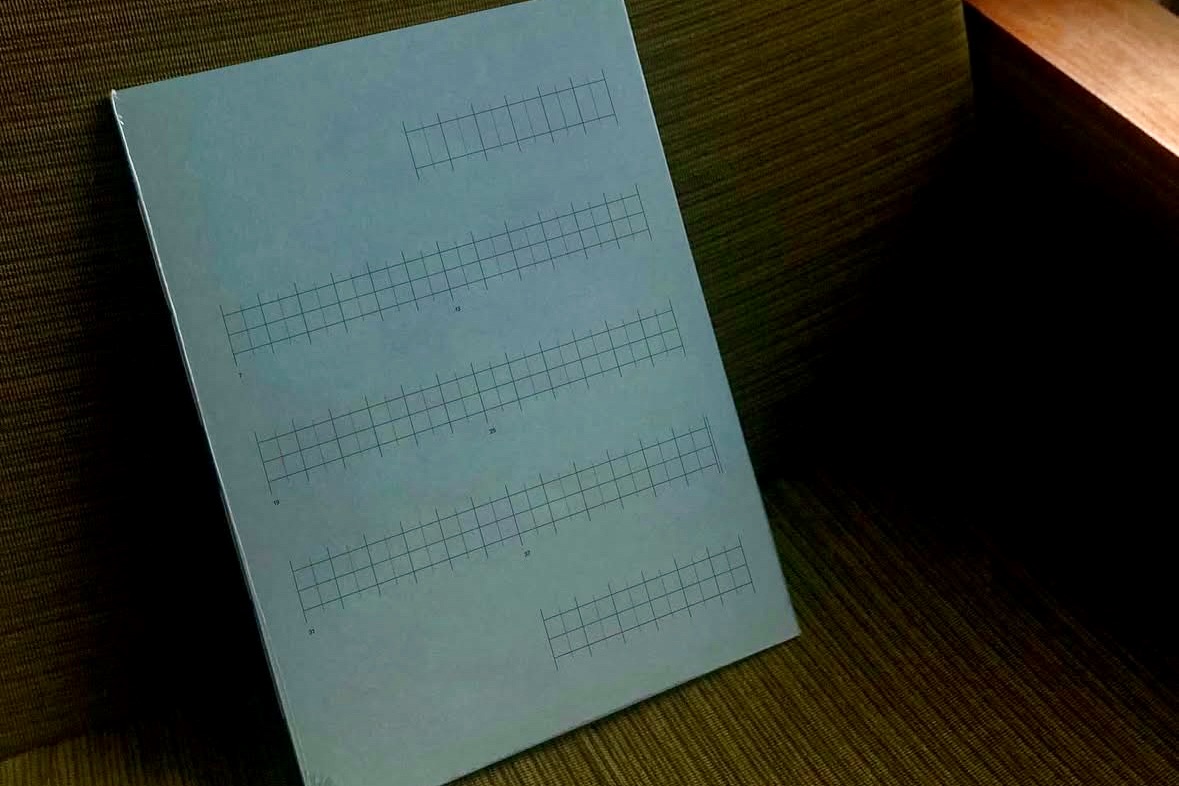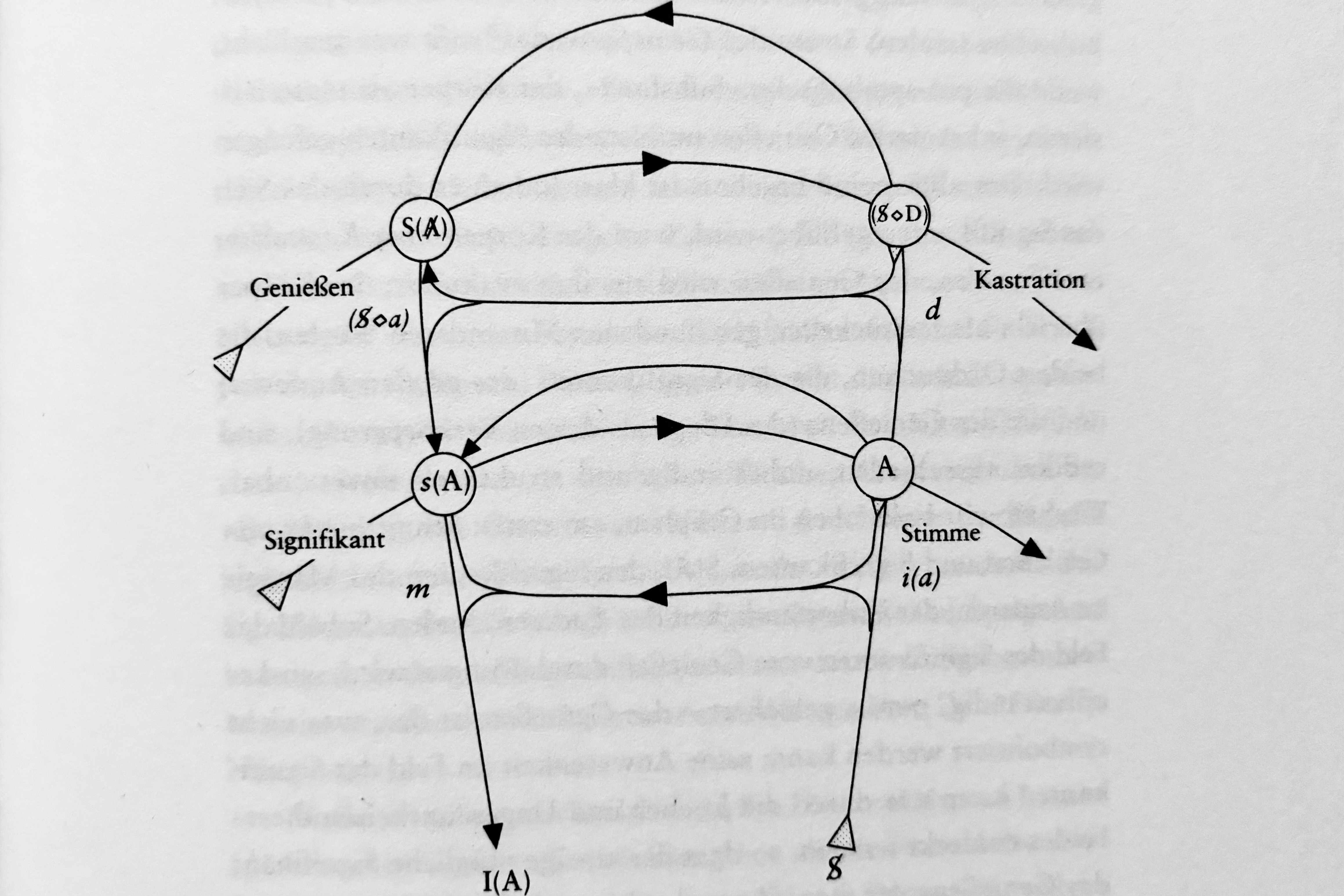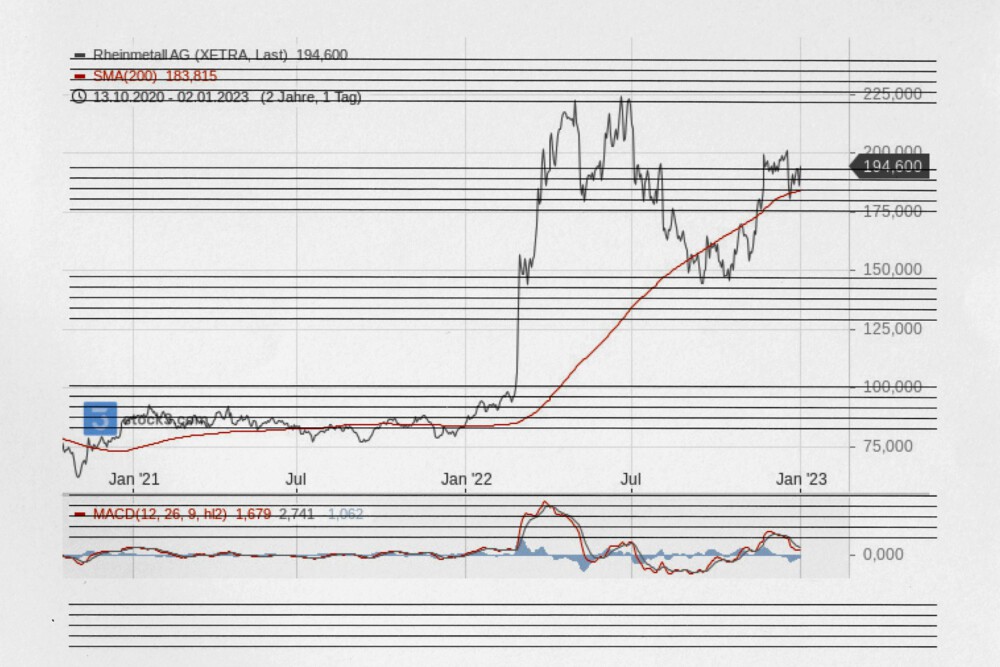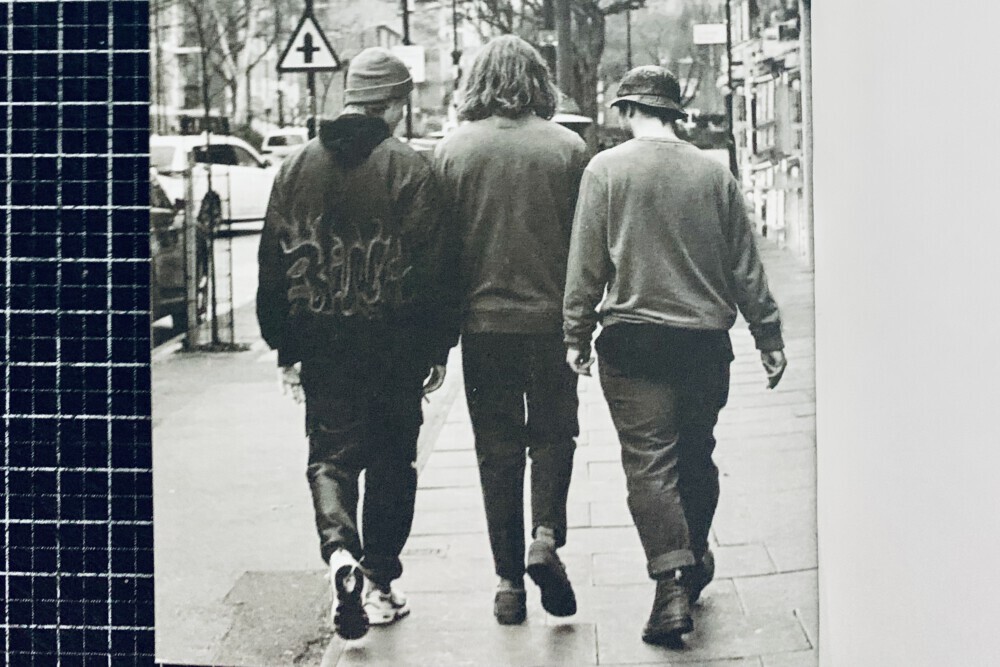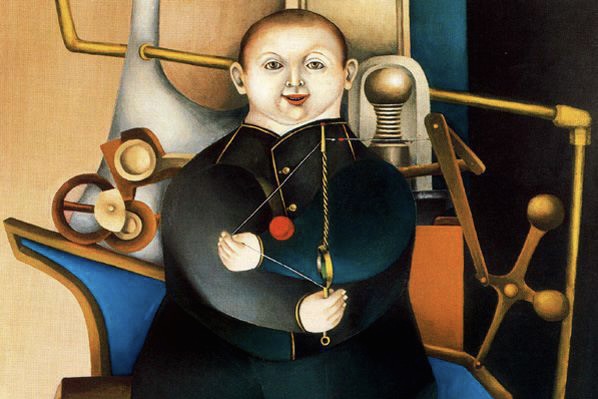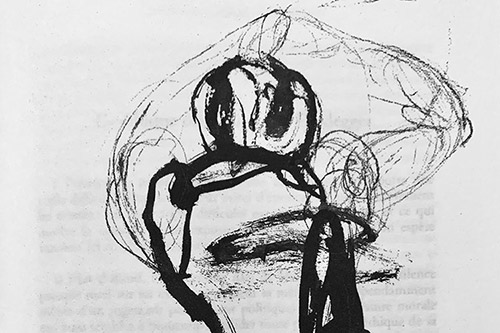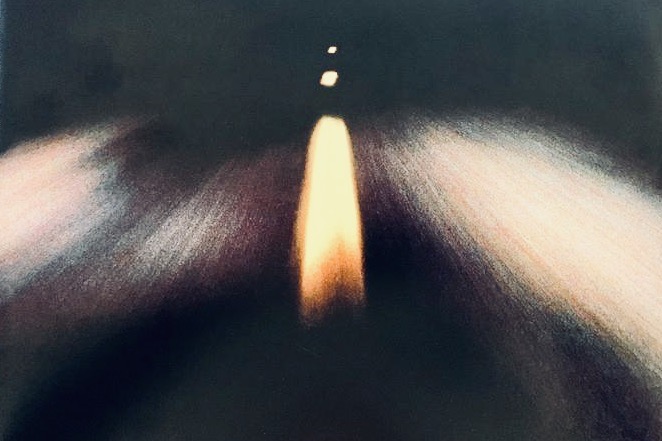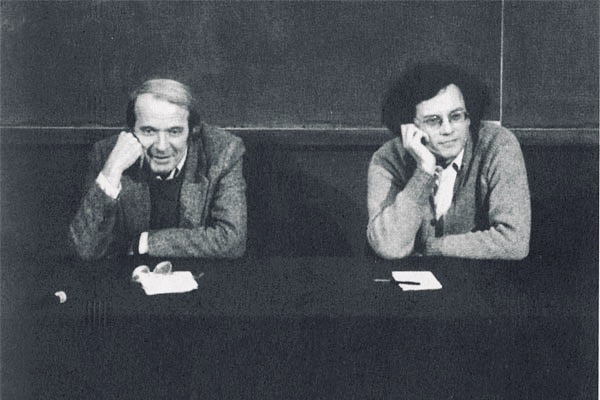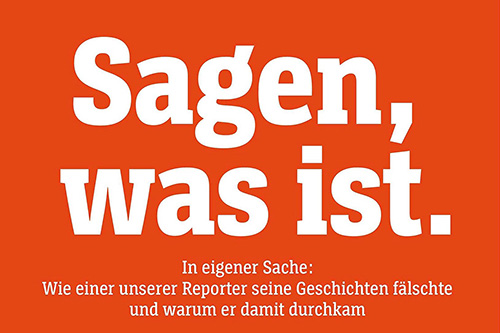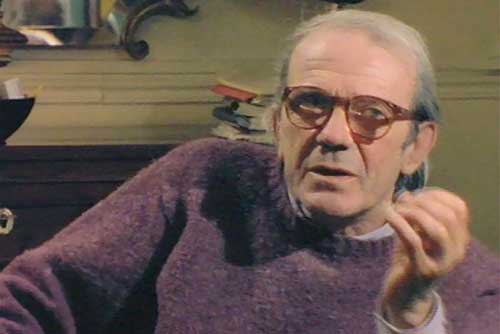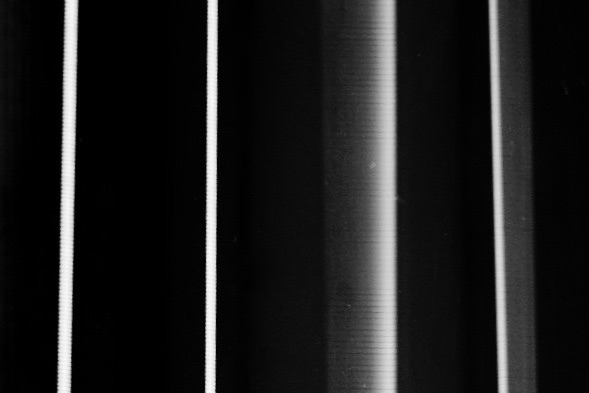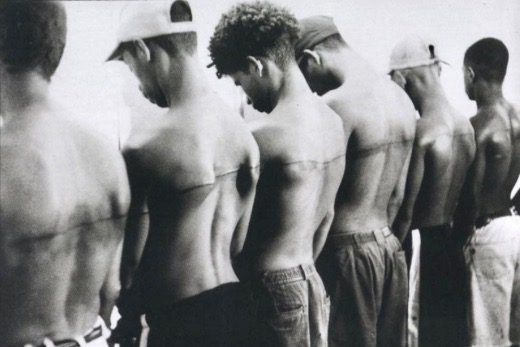Januar 2025
Digitale Idiotie
Eine kritisch-affirmative Epistemologie des Algorithmischen
»Zwischen Größenwahn und Machtlosigkeit, globalen Perspektiven und dem alltäglich Belanglosen verortet, spannt das Idiotische also eine provisorische Folie aus, um ein kritisch-affirmatives Konzept künstlerischer Intelligenz mit Bezug auf die politische Wirklichkeit des Digitalen und KI zu denken. Der Idiot steht stets im »Inmitten«. Er bewertet nicht und hat keine »Meinung« in einem normalisierten Sinn. Denn das Subjekt, aus dem diese auftauchen könnte, ist zu schwach, wobei die Empfindsamkeit fürs Außen zugleich als zu stark gewertet wird. Zwei Kräfte wirken im Idiotischen somit gleichzeitig, die es zu zerreißen drohen, um aus dieser Spannung kreative Energie zu beziehen.«
Text lesen English Version
Januar 2025
Die Kunst des Scheiterns
Notizen zur Fehlerkultur
»›Aus Fehlern lernt man‹, so sagt man zumindest. Doch welche Wendung nimmt diese Formel in der Theorie und Praxis des Lernens? Und wie können Fehler als fester Bestandteil didaktisch angeleiteten Handelns systematisch erschlossen werden? Ihrem Wesen nach sind sie ja unvorhersehbar und somit nicht berechenbar. Welche ideologischen Fallstricke gilt es beim Ausrufen der Chancen einer vermeintlichen ›Fehlerkultur‹ dementsprechend zu beachten?«
Text lesen Zum Heft
Januar 2025
Poststrukturalistische Ansätze
Eintrag für ein Analyse-Handbuch
»Poststrukturalistische Ansätze musikalischer Analyse gewinnen ihre methodische Ausrichtung und inhaltliche Schwerpunktsetzung aus Denkfiguren des sogenannten Poststrukturalismus (bisweilen auch ›French Theory‹, ›Theorie der Postmoderne‹, ›Dekonstruktion‹, ›Neostrukturalismus‹, ›Differenzphilosophie‹, seltener ›Konstruktivismus‹ oder ›Antihumanismus‹), einer in den 1960er und 70er Jahren in Frankreich aufgekommenen Theorieströmung, die bis heute eine weitverzweigte und international verstreute Rezeption erfahren hat. Wie der Poststrukturalismus im Allgemeinen geht auch dessen Rezeption in der Musikforschung häufig mit einer politisch motivierten Geste der Zurückweisung traditioneller Verfahrensweisen akademischer Wissensproduktion einher, die sich im Zusammenhang der Theorie und Praxis musikalischer Analyse in einer Reihe bewusst provokativ bzw. ›unkonventionell‹ gehaltener Beiträge bemerkbar gemacht hat ...«
2025
November 2025
Das Zenonzän – Paradoxien des Fortschritts
Buchvorstellung mit Isabell Cole im Hamburger Schauspielhaus am 17.11.25
»Bei der Rekonstitution der Bewegung durch das Unbewegte, die sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der philosophischen Bewegungstheorie ziehen wird, geht Zenon von Elea noch drastischer zu Werke als sein Vorgänger Pythagoras. Er verschiebt den Ursprung der Bewegung nicht in ihr transzendente Regionen, sondern versucht, durch sein ›Pfeil-Paradoxon‹ aufzuzeigen, dass es Bewegung gar nicht gibt. Alles ist Zenon zufolge schon in Ruhe, die Bewegung bloße Illusion. Der zuverlässigste Weg, philosophisch zu zeigen, dass es etwas nicht gibt, besteht darin, die Annahme, etwas falle unter seinen Begriff, ad absurdum zu führen : »Der Pfeil, der sich schnell bewegt, steht still.« So lautet die Konklusion von Zenons Argument, durch das er die These seines Lehrers Parmenides untermauern will, dass die Einheit des Seienden bewegungslos ist.«
November 2025
Der Holländer im MARKK
Ein dekoloniales Opernprojekt (14. & 16.11.25)
»Wagners Werke wirken weiterhin widersprüchlich. Während sich die einen durch sie zu Jubelstürmen auf dem ›grünen Hügel‹ in Bayreuth hinreißen lassen, lehnen die anderen den mit ihnen verbundenen musikdramatischen Ansatz kategorisch ab. ›Wagners Kunst ist krank‹ bemerkte einst bereits Friedrich Nietzsche in einem seiner späten philosophischen Texte. Und das, obwohl er ein paar Jahre zuvor noch zu Wagners größten Bewunderern gezählt hat. Wagner spaltet also selbst die Gemüter seiner eigenen Anhänger:innenschaft, was heute als ebenso ästhetisch aktuell wie politisch bedenklich erscheint. Insbesondere die antisemitischen Bedeutungsschichten sowie die überdeutlichen Resonanzen mit der europäischen Kolonialgeschichte bohren sich wie ein giftiger Stachel in eine widersprüchliche Rezeptionsgeschichte, um sie auf diese Weise immer wieder neu vor sich herzutreiben ...«
November 2025
Die technologische Bedingung
Interne Fachtagung ARTILACS
Das Thema ›Künstliche Intelligenz‹ verführt zur Interpretation. So zirkulieren sowohl in der Alltagswahrnehmung, im Feuilleton oder in heftig geführten Fachdiskursen etliche Mythen, Projektionen und theologische Restbestände, die dem Diskurs rund um KI eine turbulente Schubkraft verleihen: Übernimmt ›die Technik‹ bald die Weltherrschaft? Sind wir als Zivilisation im Zeichen denkender Maschinen dem Untergang geweiht? Führt der technologische Fortschritt ins ökologische Verderben, indem einer arbeitsteiligen Gesellschaft endgültig der Garaus gemacht wird? Die Fachtagung tritt hier ein paar Schritte zurück und ganz bewusst auf die ›empirische Bremse‹. Wir wollen uns im Verbund einen Tag lang mit technischen Fakten rund um KI befassen, aktuelle technische Entwicklungen in einer Verbindung von ›KI‹ und ›Kunst‹ betrachten und uns auch mit den absehbaren Grenzen einer oft als potentiell unendlich dargestellten Technologie zuwenden.
Weitere Informationen Programm
Oktober 2025
Cultural Studies Hip Hop
Kollaboratives Seminar @HfMT diversity studies
»Sehr geehrte Homies, liebe Studierende, das Seminar Cultural Studies Hip Hop startet am 13. Oktober 2025 in der Cypher Höhle, Raum U11 Budge um 15 Uhr! Das Seminar wird von den diversity Studies der HfMT für Studierende aller möglichen Fachrichtungen angeboten, die sich mit der größten Jugendkultur der Welt und der an diese angrenzenden popkulturellen Diskurse beschäftigen wollen. In diesem Semester beleuchten wir Themen wie Sampling as an Artform, Conscious Rap und Black American History, Rap Slang und Auswirkungen auf die Jugendkultur und Nischenthemen wie Rap aus der Golden Era und Dirty South Rap oder G-Funk. Wir werden wieder illustre Gäste featuren, die uns Rap und Hip Hop Kultur aus ihrer Sicht erzählen. And if you dont know – now you know! Dr. Benjamin Sprick und Jan Schlüter aka. Slim Schlüdy«
Weitere Informationen Seminarplan
Oktober 2025
Wider den Faschismus – Die kapitalistische Illusion
Im Keller der Metaphysik#6 mit Jenny Kellner
»Die historischen Beziehungen von Faschismus und Kapitalismus sind ausführlich beschrieben worden. Aktuell scheinen sie jedoch in eine neue Form der Interaktion einzutreten, die nach einem veränderten Vokabular verlangt. Wo libertäre Ideologien die Zerstörung staatlicher Strukturen vorantreiben und sich Finanzoligarchen in den aufgerissenen Leerstellen einrichten wollen wird eine erdrutschartige Eigendynamik freigesetzt, die die globale Unternehmung ins Verderben reißen könnte. Wir legen daher im »Keller der Metaphysik« die philosophischen Spuren einer lange zurückreichenden Tradition kapitalismuskritischer Faschismusanalyse frei, um sie auf den aktuellsten ›state of the art‹ zu beziehen.«
Weitere Informationen Tickets kaufen Verlagswebsite
Oktober 2025
ARTILACS PROGRAM
Wintersemester 2025/26
Was passiert, wenn künstlerisches Denken und Künstliche Intelligenz (KI) aufeinandertreffen? Welche neuen und ›latenten‹ Wissensräume entstehen dann? Inwiefern zeitigt eine Kombination von ›KI‹ und ›Kunst‹ politische-ästhetische Folgen? Solchen Fragen widmet sich das frisch bewilltigte Graduiertenkolleg ARTILACS – Artistic Intelligence in Latent Creative Spaces – das von vier Hamburger Hochschulen und zwei Partnerinstitutionen in Lübeck kooperativ gestaltet wird. Ins Zentrum rückt dabei das epistemische Prinzip der affirmativen Kritik: KI wird von ARTILACS weder euphorisch gefeiert noch reflexhaft abgelehnt, sondern in ihren Möglichkeiten und Potentialen, insebsondere für eine ›künstlerisch‹ verfasste Forschung befragt.
Weitere Informationen Programm
Oktober 2025
Theatrale Widerständigkeit
Essay für die ZWOELF, zusammen mit Katharina Alsen
Wenn von »Widerstand« die Rede ist, klingt oft das Pathos der großen Tat mit: ein klarer Gegner, eine entschlossene Handlung, vielleicht sogar die Aussicht auf Sieg. »Widerständigkeit« dagegen arbeitet leiser, sperriger – und ist gerade in den Künsten treffend für das, was sich zwischen Anpassen und Aufbegehren bewegt. Minimale Störungen, unerwartete Gesten oder subtile Momente der Verweigerung lassen Ordnungen brüchig werden, ohne sie zu stürzen. Theater und andere Institutionen werden so weniger zur Bühne des offensichtlichen Widerstands als zu Erfahrungsräumen im Wechselspiel von Ohnmacht und Ermächtigung, in denen kleine Handlungen die bestehenden Logiken irritieren und dabei ihr kritisches Potenzial entfalten. So verstanden ist Widerständigkeit kein klar umrissener Begriff, sondern ein tentatives Konzept, das sich über Ambivalenzen entfaltet. Vielgestaltig, situativ und ästhetisch geprägt, manifestiert sie sich nicht in spektakulären Konfrontationen, vielmehr in feinen, oft unscheinbaren Strategien, die sogar unterhalb der Wahrnehmungsgrenze operieren. Sie verweigert Eindeutigkeit, sucht Lücken und Zwischentöne; sie fügt sich ein und unterläuft gleichzeitig Erwartungen ...
November 2025
Das Zenonzän. Paradoxien des Fortschritts
Buchpräsenatation mit Isabell Fargo Cole (17.11.25)
Bei der Rekonstitution der Bewegung durch das Unbewegte, die sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der philosophischen Bewegungstheorie ziehen wird, geht Zenon von Elea noch drastischer zu Werke als sein Vorgänger Pythagoras. Er verschiebt den Ursprung der Bewegung nicht in ihr transzendente Regionen, sondern versucht, durch sein ›Pfeil-Paradoxon‹ aufzuzeigen, dass es Bewegung gar nicht gibt. Alles ist Zenon zufolge schon in Ruhe, die Bewegung bloße Illusion. Der zuverlässigste Weg, philosophisch zu zeigen, dass es etwas nicht gibt, besteht darin, die Annahme, etwas falle unter seinen Begriff, ad absurdum zu führen : »Der Pfeil, der sich schnell bewegt, steht still.« So lautet die Konklusion von Zenons Argument, durch das er die These seines Lehrers Parmenides untermauern will, dass die Einheit des Seienden bewegungslos ist. Bei den Eleaten erwies sich die Problematik der Bewegung als Frage nach dem Verhältnis von Denken, Sinnlichkeit und Wirklichkeit. Sie kamen zu dem Schluss, dass sich das Denken widerspricht, wenn es behauptet, dieses oder jenes bewege sich, denn damit behaupte es, dieses oder jenes ist und ist nicht (jetzt an einem bestimmten Ort) ...
Weitere Informationen Verlagswebsite
Juni 2025
Cuteness – Aporien der Niedlichkeit
Seminar im Dekanat ZWOELF (›Studium Generale‹)
Was macht jemanden oder etwas »niedlich« – und warum wirkt das so machtvoll auf uns? Niedliches stimuliert uns nicht nur auf kognitiver Ebene, sondern wird im Sinne einer Affektästhetik auch in körpernahe Reaktionen übersetzt. Diese reichen vom Impuls, etwas zärtlich zu berühren oder zu schützen, bis zur sogenannten Cute Aggression, die entsteht, wenn Niedlichkeit übermäßig stark erlebt wird. In diesem Seminar untersuchen wir das kulturelle Phänomen der Cuteness in einer komplexen Gegenwart: zwischen affektiver Überwältigung, populärer Ästhetik und kritischer Praxis. Auf den ersten Blick scheint Niedlichkeit eine Position der Schwäche zu markieren. Sie wirkt verletzlich, weich, infantil, naiv – Eigenschaften, die in der Kulturgeschichte oft abgewertet und marginalisiert wurden. Doch gerade in dieser vermeintlichen Unterlegenheit liegt ihr ambivalentes Potenzial: Niedlichkeit kann gesellschaftliche Normen der Härte oder Coolness irritieren und alternative Formen von Stärke und Bedeutung eröffnen.
Oktober 2025
ARTILACS II – The Body-Mind Issue
Online-Seminar im Graduiertenkolleg
Können Maschinen denken? Inwiefern wären sie ›intelligent‹? Was heißt überhaupt »Intelligenz«? Und welche kulturgeschichtlichen Belastungen lassen sich ausgehend von diesem Begriff freilegen? Im Seminar fahren wir fort, die epistemologischen Implikationen des Akronyms ARTILACS (Artistic in Latent Creative Spaces) systematisch zu entfalten. Nachdem wir uns im ersten Semester vor allem mir politischen Aspekten Künstlicher Intelligenz und algorithmisch geprägter Kunst-Gefüge befasst haben, rückt in diesem Semester die Bewusstseinsphilosophie in den Fokus der Aufmerksamkeit und mit ihr aktuelle Theorien künstlicher Intelligenz. Ein Schwerpunkt wird dabei auf der Frage liegen, inwiefern sich im Furor vermeintlich ›intelligent‹ operierender maschineller Systeme ein ebenso altes wie metaphysisch belastetes Problem ›eurozentristischer‹ Subjektwerdung verborgen liegt. Von dieser Frage ausgehend ließen sich womöglich erste konzeptionelle und wissenschaftlich weiterführende Konzepte ›Künstlerischer Intelligenz‹ entwerfen.
Weitere Informationen Seminarplan
Oktober 2025
Affirmative Nachhaltigkeit
Seminar an der Theaterakademie der HfMT
Die Klimakrise, ökologische Transformationen, soziale Ungleichheit – all das sind drängende Themen unserer Gegenwart. Oft wird dabei auf technische Lösungen verwiesen, auf politische Maßnahmen oder wirtschaftliche Steuerung. Was dabei zu kurz kommt, ist die kulturelle Imagination: Welche Zukunftsbilder wollen wir überhaupt entwerfen? Und wie lässt sich Nachhaltigkeit so denken, dass sie nicht primär mit Verboten oder Mangel verknüpft ist, sondern mit Lust, mit Gestaltung, mit Beziehung? Gerade die performativen Künste bieten hier einen produktiven Erfahrungsraum. In ihnen lassen sich Beziehungen neu choreografieren, Materialflüsse umdeuten, Rhythmen und Körper in andere Konstellationen versetzen. Nachhaltigkeit wird in gesellschaftlichen Kontexten häufig als Zumutung verstanden: als Aufforderung zur Einschränkung, zur Reduktion, zum Verzicht. Doch in der künstlerischen Praxis kann dieser Verzicht – etwa auf große Bühnenbilder oder energieintensive Produktionsweisen – zur Quelle ästhetischer Innovation werden: Minimalismus, Umnutzung oder Prozesshaftigkeit erscheinen nicht als Defizit, sondern als kreative Herausforderung.
Weitere Informationen Seminarplan
Oktober 2025
Die Methode der Dramatisierung
Essay für die ZWOELF
Wissenschaftliches Arbeiten wird in der Regel mit kühler Rationalität und einer distanzierten Form der Selbstbeherrschung in Verbindung gebracht. »Wer denkt, ist nicht wütend« konstatiert beispielsweise Theodor W. Adorno und ruft damit ein gängiges Klischee akademischer Wissensproduktion ins Gedächtnis, das weiterhin wirksam ist: Wissenschaftler:innen sollen bedächtig vorgehen, nicht überhastet. Ihre Erkenntniswege sind von seriöser Langsamkeit geprägt, überstürztes Handeln liegt ihnen fern. »Nur durch strenge Spezialisierung«, so formuliert es der Soziologe Max Weber in seiner Studie Wissenschaft als Beruf (1919), »kann der wissenschaftliche Arbeiter tatsächlich das Vollgefühl, einmal und vielleicht nie wieder im Leben, sich zu eigen machen: hier habe ich etwas geleistet, was dauern wird.« Eben diese ›Dauer‹ und Verbindlichkeit jedoch – von der auch Webers eigene Forschung getragen wird – beginnt zunehmend zu wanken ...
Beitrag lesen Aktuelle ZWOELF herunterladen
Oktober 2025
Künstlerische Forschung – Aktuelle Theorie und Best-Practice
Seminar im Dekanat 12 der HfMT
Als epistemologisches Feld ist das, was als »Künstlerische Forschung« oder »artistic research« bezeichnet wird dabei, sich sowohl methodisch zu differenzieren als auch akademisch zu konsolidieren. Im Kurs diskutieren wir die Möglichkeiten und Herausforderungen dieser Bewegung mit Blick auf Anschlussmöglichkeiten an konkrete Forschungsvorhaben. Wir rezipieren und diskutieren in jeder Sitzung jeweils eine aktuelle Position zum Thema, die wir mit sogenannten Best-Practice-Beispielen in Beziehung setzen. Auf diese Weise sollen Inspiration und Vokabular für eigenständige Forschungsdesigns und -methoden ermöglicht werden ...
.
Weitere Informationen Einschreiben
Oktober 2025
Einführung in Methoden Künstlerischer Forschung
Seminar an der Musikhochschule Lübeck
Die Klimakrise, ökologische Transformationen, soziale Ungleichheit – all das sind drängende Themen unserer Gegenwart. Oft wird dabei auf technische Lösungen verwiesen, auf politische Maßnahmen oder wirtschaftliche Steuerung. Was dabei zu kurz kommt, ist die kulturelle Imagination: Welche Zukunftsbilder wollen wir überhaupt entwerfen? Und wie lässt sich Nachhaltigkeit so denken, dass sie nicht primär mit Verboten oder Mangel verknüpft ist, sondern mit Lust, mit Gestaltung, mit Beziehung? Gerade die performativen Künste bieten hier einen produktiven Erfahrungsraum. In ihnen lassen sich Beziehungen neu choreografieren, Materialflüsse umdeuten, Rhythmen und Körper in andere Konstellationen versetzen. Nachhaltigkeit wird in gesellschaftlichen Kontexten häufig als Zumutung verstanden: als Aufforderung zur Einschränkung, zur Reduktion, zum Verzicht. Doch in der künstlerischen Praxis kann dieser Verzicht – etwa auf große Bühnenbilder oder energieintensive Produktionsweisen – zur Quelle ästhetischer Innovation werden: Minimalismus, Umnutzung oder Prozesshaftigkeit erscheinen nicht als Defizit, sondern als kreative Herausforderung.
Weitere Informationen Seminarplan
Mai 2025
Zur Anthropologie Digitaler Arbeit
Abendgesellschaft des AHJL e.V.
»Der Begriff der Arbeit bezeichnet bei Marx nicht einfach eine Naturbedingung menschlichen Lebens und ebenso wenig eine anthropologische Gegebenheit. Wo sich die Kritik solchen Vorstellungen zu nähern scheint, da zerfallen sie sofort in andere Bestimmungen, mit denen sie korrespondieren oder die an ihre Stelle treten, um etwas ganz anderes zu sagen. Es gibt keinen kohärenten Begriff der Arbeit bei Marx. Es gibt multiple Sequenzen, die um den fehlenden Begriff der Arbeit kreisen. Entfremdete Arbeit, Arbeit als Selbstverwirklichung und Entwirklichung; konkrete und abstrakte Arbeit; produktive und unproduktive Arbeit; lebendige und tote Arbeit; und schließlich: Arbeit überhaupt, »Arbeit sans phrase« – überall verzweigen und vervielfachen sich die Bestimmungen, kommentieren sie wechselseitig ihr Ungenügen, um von etwas ganz anderem zu sprechen ...« (Hans-Joachim Lenger, Marx zufolge)
...
Mai 2025
Latente Potenzen
›Kick-Off‹ ARTILACS am 09.05.25
Die Fragestellung unseres Kollegs ist ebenso umfassend, wie sie als originell und zeitgebunden erscheint. Sie betrifft zum einen viele Aspekte der politisch-ästhetischen Aktualität aber auch solche, die weit in die europäische Kulturgeschichte hinein- und auch zurückreichen. Künstlerische Produktion und technologischer Fortschritt waren immer schon eng miteinander verquickt, sie unterhalten eine ganze Reihe historischer und auch systematischer Beziehungen, deren Ursprünge sich im Dunkel ihrer eigenen Frühe verlieren. ›Irgendwie‹ und ›Irgendwann‹ war Kunst also immer schon technisch und Technologie immer schon kreativ. In gewisser Weise handelt es sich bei beiden um Zwillinge bzw. konkurrierende Geschwister, die aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und Motivationslagen heraus die Bedingungen ihrer Wirklichkeit kreativ in die Präsenz ziehen wollen und sich dabei überlagern, voneinander abgrenzen und vermischen ...
Weitere Informationen ARTILACS
März 2025
Autoritärer Kapitalismus
Gespräch mit Joseph Vogl [Im Keller der Metaphysik#4]
»Warum kämpfen die Menschen für ihre Knechtschaft, als ginge es um ihr Heil?« (Baruch de Spinoza, Politisch-theologischer Traktat) Angesichts erdrutschartiger Erosionen einer politischen (Welt-)Öffentlichkeit, die von ebenso rastlosen wie unheilvollen Allianzen zwischen Kapitalmacht und autoritärer Politik vorangetrieben werden, liegt es nahe, sich für eine kurze Denk- und Atempause in einem Keller zu verschanzen, um dort nach geeigneten Antworten auf die sich abzeichnende Misere zu suchen. Als Gesprächspartner und Ideengeber haben wir den Spezialisten für Plattformökonomie und Kapitalismusanalyse Joseph Vogl eingeladen, der uns mit Blick auf eine politische Diagnostik der Gegenwart auf die Sprünge helfen wird. Dabei lassen sich Gedankenfiguren aus Vogls fulminanter Studie Kapital und Ressentiment (2021) ebenso aufgreifen und aktualisieren, wie sein neuestes Buch Meteor. Versuch über das Schwebende zitiert wird, das im Februar dieses Jahres im Münchener Beck Verlag erscheint.
...
Weitere Informationen Gespräch hören
März 2025
ADORNO im Übel & Gefährlich
30.03.2025
Adorno bleibt gefährlich. Sein Denken insistiert, sprachlich, politisch, künstlerisch. Seine Syntax fordert uns heraus. Sie bietet gedanklichen Schutz inmitten einer Zeit, in der sprachliche Regression zum wohlkalkulierten politischen Mittel avancierte. Adorno muss erneut, muss ›quer‹ gelesen werden. Auf diese Weise lassen sich Gedankenfiguren gewinnen, die ein »Nicht weiter so« ermöglichen. – In Zeiten von »Mikroblogging-Diensten«, wie X oder »Kurzvideo-Portalen« wie Tik Tok, wirken Adornos Texte als endgültig in die Jahre gekommen. Sie passen in kein Format und sperren sich der ballistischen Schlagkraft meinungshafter Kurznachrichten. Aber darin besteht ihre Aktualität! – Im »Fahrstuhlteil« des Abends lesen wir aus Gisela von Wysockis Roman WIESENGRUND eine herrliche Fahrstuhlgeschichte, die sie als Studentin mit Adorno in Frankfurt erlebt hat.
Juni 2025
Decolonize philosophy!
Gespräch mit Katja Diefenbach [Im Keller der Metaphysik#5]
»Wir könnten nochmal über Marx diskutieren wir können über Bloch und andere Formen oder postmarxistische Formen reden, da müssten wir uns jetzt darüber einigen, auf welche Frage der Analyse von Vergesellschaftungregimen wir uns einlassen wollen. Der Vorschlag, um den es mir geht ist, dass es wie ich glaube nicht geht, ohne dass man versucht ökonomische Regime und kapitalistische Regime zusammen mit Rassifizierungs- und Vergeschlechtlichungsprozessen zu denken. Aber dass die intersektionale Sicherheit alleine nicht ausreicht, sondern dass man sich jeweils historisch-spezifisch genauer angucken müsste, wie genau denn eigentlich diese Sachen verschaltet sind. Und dass sie natürlich in einem zeitlichen Raum oft sehr heterogen oder »gegeneinander« aufgestellt sind in asymmetrischen Entanglement. So etwas zu analysieren wäre vielleicht etwas, das wir für unsere Gegenwart versuchen könnten.« (Katja Diefenbach)
Weitere Informationen Gespräch hören
April 2025
Palliative Ästhetik
Seminar im Dekanat 12 der HfMT
Palliative Ästhetik ist eine Ästhetik, die sich mit ihrem nahenden Ende befasst. Sie gibt den Anspruch auf das Gute, Wahre und Schöne auf und hofft nichts mehr – um hieraus neue Hoffnung zu schöpfen. Palliative Ästhetik ist dementsprechend eine Ästhetik im Angesicht der drohenden Klimakatastrophe. Sie drängt auf Beschleunigung, weil sich der Untergang der Welt im Rahmen des Klimawandels schleichend und langsam vollzieht. Die faktische Gefahr lässt sich hier lediglich unbewusst, im irritierenden Gefühl eines »Ökologisch-Unheimlichen« (Juliane Rebentisch) erfahren. Wie reagieren die Künste auf diese fundamentale Krise der Bedingung ihrer eigenen Möglichkeit? Wo flieht sich der Musik- und Theaterbetrieb in die routinierte Ideenlosigkeit eines »Weiter so«? Wie können wir gemeinsam daran arbeiten, künstlerisch angemessen auf die auf uns zukommenden Apokalypsen zu reagieren? [Montags 10-11.30 Uhr, Beginn 07.04.25]
März 2025
Methoden künstlerischer Forschung
Seminar im Promotionsstudiengang Dr. sc. mus.
Methoden künstlerischer Forschung wuchern ebenso, wie sie in ihrer epistemischen Vielfalt unübersichtlich bleiben. Das hat durchaus systematische Ursachen. Künstlerische Forschungsvorhaben müssen ihre Methodik mit ihrem Forschungsgegenstand gemeinsam entwickeln und sie dabei in gewisser Weise für die angepeilte Forschungsbewegung ›maßschneidern‹. Es gibt in diesem Sinne kein fest gefügtes und auf einer akademischen Übereinkunft beruhendes Methodenarsenal Künstlerischer Forschung. Das auf Lektüre und Textstudium fokussierte Seminar versucht in dieser unübersichtlichen Situation so etwas wie eine erste Orientierung zu schaffen. Dabei sollen einerseits aus bereits bestehenden Publikationen methodische Grundlinien extrahiert, aber auch aus nicht genuin künstlerischen Forschungszusammenhängen auf die künstlerische Methodik übertragen werden, um auf diese Weise – auch in Form eines komplikationslos zugänglichen digitalen Archivs – so etwas wie ein provisorisches methodisches ›Repertoire‹ zu skizzieren, das Möglichkeiten eigenständiger epistemischer Improvisationen eröffnet. [Montags 12-14 Uhr, Beginn 07.04.25]
März 2025
Theorien Kultureller Appropriation
Lektürekurs (HfMT Diversity Studies)
»Kulturelle Aneignung (englisch cultural appropriation) bezeichnet die Übernahme von Ausdrucksformen, Artefakten, ästhetischen Zeichensystemen, Geschichte und Wissensformen von Trägern einer anderen Kultur oder kulturellen Identität. Im wissenschaftlichen Austausch ist der Begriff neutral und bekommt erst im konkreten Zusammenhang eine positive oder negative Konnotation (etwa Ausbeutung oder Bereicherung). Die Beurteilung ist häufig schwierig und gelingt nur unter Berücksichtigung der Motivation der Aneignenden: Sind Machtausübung, kommerzielle Interessen oder Diskriminierung die tieferen Beweggründe oder handelt es sich um unreflektierte (etwa romantisch-naive), wohlmeinende oder gar anerkennende Übernahmen? In einem engeren Sinn wird als »kulturelle Aneignung« angesehen, wenn Träger einer dominanteren Kultur Kulturelemente einer Minderheitskultur übernehmen und sie »ohne Genehmigung, Anerkennung oder Entschädigung« in einen anderen Kontext stellen ...« [Montags 14-15:30, Beginn 07.04.2025]
Weitere Informationen Seminarplan
März 2025
ARTILACS!
Theorie-Seminar am Ligeti-Center
Das frisch von der Landesforschungsförderung bewilligte Graduiertenkolleg ARTILACS (Artistic Intelligence in Latent Creative Spaces) rückt das Konzept »Künstlerischer Intelligenz« in den Fokus. Damit wird eine kritisch-affirmative Auseinandersetzung mit den Entwicklungen der Künstlichen Intelligenz im Kontext künstlerischer Praxis adressiert. ARTILACS soll untersuchen, inwiefern eine hybride Kombination aus KI-gestützten, latenten Räumen und traditionellen Wissensräumen der künstlerischen Praxis Chancen für neue Formen von Kreativität und Erkenntnis eröffnet. Im Seminar wollen wir versuchen, die der Arbeit des Kollegs zugrunde gelegte epistemologische Fragestellung ausgehend von aktuell(s)ter Forschungsliteratur zum Thema der Künstlichen Intelligenz und ihrer Rolle in den Künsten näher zu umreißen ... [Donnerstags 12-14 Uhr, Beginn: 10.04.25]
März 2025
Hip Hop – Schule der Subkultur
Praxis-Seminar, zusammen mit Slim Schlüdy (HfMT Diversity Studies)
Hip Hop ist die größte Jugendkultur der Welt. Sie ist tief verwurzelt in sozialen Realitäten und wirft zugleich erhebliche ökonomische Gewinne ab. Von der Hochkultur weicht Hip Hop ab, um eine eigene Politik zu verfolgen. Die Geschwindigkeit mit der Hip Hop sich entwickelt und differenziert ist atemberaubend, seine Geschichte weit verzweigt. Ein Blick in ein besser gefühltes Plattenregal reicht aus, um einen Eindruck davon zu gewinnen, inwiefern Hip Hop etwas mit diversity zu tun hat. Das Viele durchquert sich hier, Differenzen gehen auseinander hervor, um sich zugleich zu verbinden ... [Montags 16-18 Uhr (open end)]
März 2025
Online-Kolloquium »Kollektive Schreibweisen«
Schreib-Kurs für Künstlerische Forschung
Das Online-Kolloquium »Kollektive Schreibweisen« eröffnet für die Promovierenden der HfMT und anderen Studierenden, die am Prozess des Schreibens sind, die Möglichkeit ihre aktuelle Textproduktion einem virtuellen Plenum vorzustellen und gemeinsam zu diskutieren. Entsprechende Schreibversuche werden vorab an alle Teilnehmenden herumgeschickt, um dann – ausreichend vorbereitet – mit Blick auf die methodische Kohärenz, argumentative Stringenz und epistemische Originalität hin verhandelt zu werden. Auf diesem Wege können bereits vorhandene, ›asynchrone‹ Materialien und Übungs-Tools zur Frage künstlerisch-wissenschaftlicher Textproduktion gezielt angewendet werden. Ins Zentrum rückt dabei ein bestimmtes Konzept »Kollektiver Schreibpraxis«, das einen Seitenblick auf um sich greifende Technologien der KI-Textproduktion (Chat GPT) und solchen des ›Ghostwritings‹ riskiert ... [Dienstags 16:30-18 Uhr, Beginn 08.04.25]
Weitere Informationen Seminarplan
März 2025
Was ist Künstlerische Forschung?
Grundlagenarbeit an der Musikhochschule Lübeck
Was genau ist gemeint, wenn von »Künstlerischer Forschung« die Rede ist? Und welche theoretischen Positionen gibt es zum Thema? Wie lässt sich aus einer praktisch-musikalischen Perspektive an Methoden künstlerischer Forschung anschließen? Der Kurs eröffnet erste theoretische und praktische Zugänge zu einem wichtigen Thema und baut gewisse Berührungsängste ab. In Zentrum rückt dabei unter anderem die Systematik eines praktischen Forschungs-Settings und eine vertiefte Diskussion von Fragen der Instrumentaltechnik ...
Januar 2025
Denken in finsteren Zeiten
Gespräch mit Juliane Rebentisch [Im Keller der Metaphysik#3]
Der Horizont des politischen Denkens verdüstert sich. Wo Meinungsmärkte die Unterscheidung von Wahrheit und Unwahrheit einkassieren und dumpfe Ressentiments auf dem Vormarsch sind, droht die Demokratie in eine tiefe Krise zu geraten. Der „Demos“ (das (Staats-)Volk) taucht regelmäßig nicht mehr auf, sondern ab, in die Katakomben des Populismus, was das Niveau öffentlicher Diskurse ebenfalls stark abfallen lässt. Grund genug, um im »Keller der Metaphysik« nach den weit zurückreichenden Ursachen für die Misere zu forschen und einen Abend lang eine abgründige Form philosophischer Öffentlichkeit zu erzeugen ...
Weitere Informationen Gespräch anhören
Januar 2025
Radical Relaxation
Symposium an der TAH am 31.01.2025
Künstlerische Konzepte von »relaxed performance« und »Aesthetics of Accessabilty« werden in jüngster Zeit immer eingehender diskutiert. Sie antworten auf eine kaum noch einzuhegende Eigendynamik eines durchökonomisierten Kunstbetriebs, der seine Institutionen und die darin arbeitenden Menschen an ihre immanenten Grenze zu treiben droht und zur gleichen Zeit viele Mitglieder der Gesellschaft vom vermeintlichen ›Kunstgenuss‹ ausschließt und marginalisiert. Ein um sich greifender Repräsentationszwang scheint die Regie an sich gerissen zu haben, was nach Blockade, Bremsung und einer systematischen Bestreikung von Aufmerksamkeitsökonomien verlangt. Welche Formate lassen sich hier bilden, welche Strategien sind erlaubt?
Aktuelle Lehrveranstaltungen Wintersemester 25/26
Academia
2024
Dezember 2025
Der Klang der Maschine
Publikation beim Materialverlag
»Der Begriff der ›Maschine‹ ist in philosophischer Hinsicht ein Januskopf. Zum einen beschreibt er technisches und in gewisser Weise logisch-sinnfälliges Gebilde, das gewissen rationalen Kriterien zu gehorchen hat und eine präzise sprachliche Abgrenzung vor Schwierigkeiten stellt. Zum anderen eignet er sich wie kaum ein anderer Begriff zur Metaphorisierung: es gibt wenig Zusammenhänge, die sich nicht in gewisser Hinsicht auch als ›maschinisch‹ fassen ließen, eine ganze Armada maschinischer Begriffe in der deutschen Sprache zeugt davon. Dabei scheinen zwei Konstituentien wesentlich zu sein: das Funktionieren der Maschine und ein durch sie zu erreichender Effekt. Mit Maschinen auf diese Weise terminologisch in Kontakt zu treten, heißt in eine Welt der Vielheiten einzutreten, in der sich verschiedene Bedeutungen, historische Entwicklungen und künstlerische Adaptionen überlagern. Denn eine Maschine ist immer auch eine soziale Angelegenheit.«
Dezember 2024
Dionysos stottert
Beitrag für ein historisches Seminar an der Humboldt-Universität, Berlin
»Was auch diesem fragwürdigen Buche zu Grunde liegen mag: es muss eine Frage ersten Ranges und Reizes gewesen sein, noch dazu eine tief persönliche Frage, - Zeugniss dafür ist die Zeit, in der es entstand, trotz der es entstand, die aufregende Zeit des deutsch-französischen Krieges von 1870/71. Während die Donner der Schlacht von Wörth über Europa weggiengen, sass der Grübler und Räthselfreund, dem die Vaterschaft dieses Buches zu Theil ward, irgendwo in einem Winkel der Alpen, sehr vergrübelt und verräthselt, folglich sehr bekümmert und unbekümmert zugleich, und schrieb seine Gedanken über die Griechen nieder, - den Kern des wunderlichen und schlecht zugänglichen Buches, dem diese späte Vorrede (oder Nachrede) gewidmet sein soll. Einige Wochen darauf: und er befand sich selbst unter den Mauern von Metz, immer noch nicht losgekommen von den Fragezeichen, die er zur vorgeblichen "Heiterkeit" der Griechen und der griechischen Kunst gesetzt hatte; bis er endlich in jenem Monat tiefster Spannung, als man in Versailles über den Frieden berieth, auch mit sich zum Frieden kam und, langsam von einer aus dem Felde heimgebrachten Krankheit genesend, die "Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik" letztgültig bei sich feststellte. - Aus der Musik? Musik und Tragödie? Griechen und Tragödien-Musik? Griechen und das Kunstwerk des Pessimismus?« (Friedrich Nietzsche)
Dezember 2024
ARTILACS
Bewilligung eines Graduiertenkollegs an der HfMT
Nach dem positiven Förderbescheid der Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke der Hansestadt Hamburg wird das Graduiertenkolleg ARTILACS – Artistic Intelligence in Latent Creative Spaces unter Federführung der HfMT Hamburg im kommenden Jahr seine Arbeit aufnehmen. Das künstlerisch-wissenschaftliche Verbundprojekt von vier Hamburger Hochschulen – HAW Hamburg, HCU Hamburg, HFBK Hamburg und HfMT Hamburg – unter Gesamtleitung von Prof. Dr. Georg Hajdu (HfMT) ist auf eine Laufzeit von 3 Jahren angelegt. ARTILACS rückt das Konzept einer »Künstlerischen Intelligenz« in den Fokus. Damit wird eine kritisch-affirmative Auseinandersetzung mit den Entwicklungen der Künstlichen Intelligenz (KI) im Kontext künstlerischer Praxis adressiert. Es soll untersucht werden, inwiefern eine hybride Kombination aus KI-gestützten, latenten Räumen und traditionellen Wissensräumen der künstlerischen Praxis Chancen für neue Formen von Kreativität und Erkenntnis eröffnet, die sich im Konzept einer »künstlerischen Intelligenz« methodologisch fassen lassen. Während der Laufzeit ist ein Zusammenschluss von Wissenschaft, Lehre und künstlerischer Praxen der unterschiedlichen Hochschulen geplant ...
November 2024
Saving the Magic Flute
Performance-Lecture bei der Ringvorlesung Genderdialoge
»In unserer westlichen Kultur ist die Zauberflöte nicht nur ein Singspiel, sie ist nicht nur künstlerisches Material. Sie ist eines der meistgespielten Werke, das als geeignet für ein breites Publikum gilt; und nicht nur das, sie wird als unveränderliches Werk betrachtet, das jeder kennen und respektieren muss, wie man ein Denkmal respektiert. Aber ist es nicht paradox, dass Musik und Theater ausgehend von einem so konkreten Ursprung - dem Manuskript - so sehr idealisiert werden, dass sie als monumentale und unveränderliche Werke gelten?Das unbeständige Territorium des Manuskripts, voller Flecken und Auslöschungen, in dem sich jedes musikalische Element verändern kann, gibt es nicht mehr: Die Zauberflöte ist Eigentum von Theatern, Verlegern, Konservatorien und der westlichen Hochkultur. Aber wie kann man die Zauberflöte auf den neuesten Stand bringen?« (Sofia Cadisco)
November 2024
Radikale Gleichheit
Gespräch mit Jule Govrin [Im Keller der Metaphysik#2]
Im »Keller der Metaphysik« muss aufgeräumt werden. Aktuell angesichts der Frage der ›Gleichheit‹, die uns in unauflösbare gesellschaftliche Probleme zu stürzen droht. Was bedeutet Gleichheit heute? Wie lässt sie sich umsetzen und konkretisieren? Wo betrifft sie uns alle gleichermaßen, wann teilt und unterscheidet sie uns? Als Philosophin, die an einer Theorie der radikalen Gleichheit und des »Universalismus von unten« arbeitet, haben wir Jule Govrin eingeladen, die uns bei unseren (mentalen) Aufräumarbeiten unterstützt. Wir sprechen mit ihr über die Suche nach gelebter Gleichheit in der Gegenwart. Dabei blitzt – im Keller - womöglich ein neuer »Universalismus von unten« auf. Ein Universalismus, der solidarische Gefüge der Sorge mit egalitären Politiken der Körper ineinandergreifen lässt ...
Weitere Informationen Gespräch anhören
November 2024
Musikalische Spontaneität
Vortrag beim Symposium DaZwischen
Es gibt Tage, an denen ein sich selbst gesetztes Vorhaben und die Bedingungen seiner Realisierung in eine gewisse ›Dissonanz‹ geraten. [2] Als ich mich gestern Morgen an meinen Vortrag über »musikalische Spontaneität« für die Tagung »Verweile doch…« an der HfMT setzen wollte, nachdem ich diese Pflicht zuvor in einer performativen Weise vor mir hergeschoben hatte, erreichte mich in meinem Unterrichtsraum 007 rot eine »Eilmeldung« derTagesschau-App. [2] Es war 8.18 Uhr und die Redaktion von ARD-aktuell vermeldete »Trump sichert sich auch Swing State Pennsylvania und steuert auf Sieg zu.« Ein weiteres finsteres Kapitel der jüngeren Weltgeschichte war aufgeschlagen, dessen politische Konsequenzen uns wohl erst in einiger Zeit in ihrer ganzen Tragweite erreichen ...
Oktober 2024
Was ist künstlerische Forschung?
Forschungsseminar mit Promovierenden der HfMT
Welches ›Wissen‹ generiert die Kunst? Wie lässt sich dieses Wissen erforschen? Inwiefern kann die eigene künstlerische Praxis durch eine Kontaktaufnahme mit wissenschaftlichen Methoden in ihrer Wirksamkeit verstärkt werden? Das Lehrangebot versucht in Sachen »Künstlerische Musikforschung« Anknüpfungsmöglichkeiten zu schaffen. Dabei wechseln sich praktische Erkundungen eines bereits bestehenden Forschungsgebietes mit theoretischen und innovativen Inputs ab. Es soll zudem versucht werden, einen politischen Aktualitätsbezug zur künstlerischen Praxis herzustellen. Erste eigenständige Forschungsprojekte der Studierenden werden am Ende des Semesters in einem innovativen Konzert-Setting präsentiert. Das Angebot richtet sich dezidiert an alle diejenigen Studierenden, die Interesse daran haben ihre eigene künstlerische Praxis experimentell zu erforschen und mit wissenschaftlichen Methoden in Kontakt zu setzen ...
Oktober 2024
Epistemic Dromology
Lecture at ArtSearch2-Symposium
»Thirdly, and most importantly in this context, in the context of a discourse on artistic research, AI will never be able to take something like a political position, a fundamental flaw from an artistic perspective, which it can even reflect on itself, as my Adobe Acrobat »AI Assistant« ›assured‹ me yesterday. Without a political position, however, without a certain politics of knowledge, the idea of artistic research would be meaningless, since no artistic knowledge could be imagined that had not been born, at least unconsciously, out of an interconnection with politics. The auxiliary science AI must therefore be well educated politically by its guiding science artistic research in order to avoid unpleasant ›slips‹. (#populism, fake news an so on) ...
...
Oktober 2024
Musikästhetik dekolonisieren
Seminar im Dekanat ZWOELF
Die europäische Musikgeschichte verweist auf eine weitverzweigte koloniale Verfallsgeschichte, die allerdings häufig in Meer der sogenannten ›Sprachferne der Musik‹ unterzugehen droht. Anders als im Fall der Literatur oder Malerei sind die Verweise und Symptome des Kolonialen in den musikalischen Kunstwerken weniger ›explizit‹, sie müssen herausgearbeitet und freigelegt werden. Das betrifft insbesondere auch das musikalische Material, mit dem die Komponist:innen in ihren Werken arbeiten. Das Seminar verfolgt das Ziel, die Grundlinien einer dekolonialen Musikästhetik zu vermitteln. Dabei reichen sich Theorie und Praxis die Hand. Es geht nicht zuletzt darum, nach zeitgemäßen Präsentationen des musikalischen Kanons zu suchen.
...
September 2024
Exzessive Subjektivität
Gespräch mit Dominik Finkelde [Im Keller der Metaphysik#1]
Subjekt zu sein bedeutet immer auch, sich selbst gesetzte Grenzen zu überschreiten. Ein Subjekt schweift aus, es kennt kein Maß. Es tritt aus dem Dunkel ihm unzugänglicher Ordnungen hervor, die sich durch diesen Austritt selbst erst bestimmen. Ein Subjekt wird somit immer erst gewesen sein. Es konstelliert sich in einem »Futur II« und arbeitet unablässig seine eigene Zukunft auf. Was bedeutet Subjektivität heute? Welche politische Zukunft wird sie gehabt haben? Aus welchen normativen Ordnungen taucht sie auf und was verführt uns, diese Ordnungen zu überschreiten? ...
Weitere Informationen Gespräch hören
September 2024
Im Keller der Metaphysik
Gesprächsreihe im MalerSaal
Wird die Metaphysik aktuell in den Keller verfrachtet, um dort in Ruhe zu verwahrlosen? Die Gesprächsreihe fragt nach aktuellen Implikationen metaphysischer Gedankenfiguren und Begriffe. Dabei ist Improvisation ebenso gefragt, wie freie Assoziation, Publikumsbeteiligung und musikalische Abwegigkeit. Die Methode der Kellermetaphysik ist wohl noch herauszuarbeiten. Fangen wir schnell damit an, jetzt, da das Hamburger SchauSpielHaus die »Realnische 0« freigelegt hat! War die Metaphysik in gewisser Weise nicht immer schon unterirdisch?
September 2024
Das Ich, die Anderen
Beitrag für die ZWOELF
Wie die von Rimbaud eingeführte Sprachakrobatik deutlich macht, spricht die poetische Sprache stets durch diejenigen hindurch, die sie verwenden. Dabei lässt sie die Beziehung von Subjekt und Objekt unscharf werden. Wer schreibt, leidet gelegentlich daran, den durch die Sprache angestrebten Sinn nicht vollständig zu erreichen. Er setzt sich der Kraft einer vorgegebenen symbolischen Ordnung aus, die seine eigene Endlichkeit übersteigt. Dementsprechend ist auch Rimbauds, unter offensichtlichen »Leiden« gefundene, poetisch-melancholische Selbstdiagnose (»Ich ist ein anderer…«) eher unzeitgemäß ...
April 2024
Hip Hop als künstlerische Praxis
Forschungsseminar im Rahmen der Diversity-Studies der HfMT
Hip Hop ist aktuell. In wohl kaum einem anderen popkulturellen Genre kristallisieren sich derartig viele Probleme einer zeitgemäßen Zeichenpolitik, die ästhetisch analysiert und praktisch weitergetrieben werden können. Wir können viel vom Hip Hop lernen, insbesondere mit Blick auf die hiesige Institution einer ›hochkulturellen‹ Wissensproduktion. Im Seminar soll – ausgehend von einer groben Nachzeichnung der Grundideen und Entwicklungslinien des Hip Hop – theoretisch und praktisch erforscht werden, inwiefern sich die Aktualität des Hip Hop künstlerisch-wissenschaftlich begreifen lässt. Dabei werden auch Künstler:innen aus der Hamburger Hip Hop-Szene zu Wort kommen: sie werden eingeladen, ihre jeweiligen Arbeiten im Seminar zu präsentieren und die damit verbundene Auslegung des Hip Hop zu erläutern...
April 2024
Aktuelle Theorien der Gemeinschaft
Seminar an der Theaterakademie der HfMT
Die Gemeinschaft zerfällt. Zugleich setzt sie sich immer wieder neu zusammen und nimmt ungeahnte Konsistenzen an. Was aber ist eine Gemeinschaft? Und worin unterscheidet sie sich von einer Gruppe, einem Ensemble, dem Kollektiv? Das Seminar fragt nach aktuellen Potentialen gemeinschaftlichen Handelns und nach den von diesen ausgehenden Ästhetiken und Politiken. Zur Kronzeugin wird dabei die theatrale Praxis, die wohl wie niemand anderes sonst etwas zur Frage des Gemeinsamen, der Gruppe und der unablässigen Bewegung der ›Dividuation‹ mitzuteilen hat. Ausgehend von kanonischen Texten der französischen Differenzphilosophie (Nancy, Blanchot, Deleuze) soll die Perspektive gezielt auf feministische, queere und postkoloniale Gemeinschaftstheorien geöffnet werden. ...
April 2024
Schönheit – Fluchtlinien einer ästhetischen Kategorie
Seminar im Dekanat ZWOELF der HfMT
Die Erfahrung des Schönen kann durchaus traumatisch sein. Sie ermöglicht Kontaktaufnahme mit dem Unendlichen, was zugleich in die Niederungen der unmittelbaren Begrenztheit führt. Demensprechend präsent ist im ästhetischen Diskurs über das Schöne die Frage nach der Hässlichkeit. Was schön ist, was hässlich, liegt dabei zunächst in den Augen der Betrachter:innen. Zugleich reichert sich diese Kategorienbildung schnell mit politisch-ästhetischem Sinn an, die aktuell in Auseinandersetzungen um Körperbilder und ästhetische Machtpolitiken zum Ausdruck kommt. Das Seminar rekonstruiert eine aktuelle Theorie des Schönen anhand diverser historischer, aktueller und abwegiger Beispiele ...
April 2024
Einführung in künstlerisch-wissenschaftliche Schreibweisen
Kurs im Promotionsstudiengang der HfMT
Wer schreibt, muss sich von dem Text tragen lassen, den er schreibt, muss sich ihm anvertrauen, in ihm »wohlfühlen« können wie in einer Fremde, die gleichwohl ein zu Hause bietet. Wie aber in einen solchen Text sich einfinden, wie ihn beginnen? Und wie in ihm fortfahren? Text-»Genres« sind hier zunächst hilfreich, weil sie den Duktus eines Textes vorzeichnen und eine gewisse Richtung vorgeben. Was aber ist eine Nachricht, was ein Kommentar, was sind Thesen, was ein Aufsatz, ein Essay, ein Traktat, eine Abhandlung? Und was sind die Spezifika einer Dissertation? Welche Elemente anderer Genres kann sie absorbieren, welcher solcher Elemente hat sie sich zu enthalten? Und worin bestehen im Übrigen die »stilistischen Eigenarten« einer Autor:in? Wie teilen sie sich einer Ausarbeitung mit, um ihr ein unverwechselbares »Timbre«, eine spezifische »Handschrift« zu verleihen? …
Weitere Informationen
März 2024
Die Matrix des Wissens
MaterialAusgabe der ZWOELF
»Ein derartig ungezeugtes Wissen, so ließe sich im Sinne des Neuen Materialismus argumentieren, stellte die dynamische Materialität einer zeitgemäßen Bildungsinstitution dar, etwas also, das sich in seiner eigenen Vermittlung überhaupt erst herausbildet und immatrikuliert. Dieses Wissen entzöge sich dem um sich greifenden Ordo einer akademischen Aufzucht fürsorglich überwachter Lernschritte, die bis ins Einzelne kalkulierbar und evaluierbar sein sollen. Es widersetzte sich gängigen Techniken einer marktförmigen Disziplinierung, die ebenso ökonomische wie ordnungspolitische Dimensionen aufweist – Beispiele hierfür sind etwa Credit Points, Akkreditierungs-Agenturen oder Qualitäts-Management – und mit denen mächtige Interessen aktuell eine Unterwerfung aller Institutionen des Wissens unter das Diktat einer Maximierung von Mehrwert vorantreiben ...«
Artikel lesen
Februar 2024
Bound to Perform
Symposium an der Theaterakademie Hamburg am 9.02.2024
»Die Formel I PREFER NOT TO schließt jede Alternative aus und verschlingt ebenso das, was sie zu bewahren vorgibt, wie sie auch jede andere Sache beseitigt; sie impliziert, dass Bartleby abzuschreiben, das heißt Worte zu reproduzieren aufhört; sie lässt eine Unbestimmtheitszone wachsen, so dass die Worte sich nicht mehr unterscheiden, sie schafft die Leere in der Sprache. Aber sie entschärft auch die Sprechakte, denen zufolge ein Arbeitgeber befehlen, ein wohlwollender Freund Fragen stellen, ein aufrichtiger Mensch Versprechungen machen kann. Würde Bartleby sich weigern, könnte er noch als Rebell oder als aufsässig ausgemacht werden und in dieser Rolle noch eine gesellschaftliche Rolle übernehmen ...«
Januar 2024
Decolonizing German Music Theory
Workshop im Rahmen der HfMT-Study-Weeks
Die Annahme, dass die ebenso gehegten, wie gepflegten Kunstwerke der europäischen Musiktradition vom historischen Kontext einer kolonialen Verfallsgeschichte unbehelligt entstanden seien, erscheint heute – so hartnäckig sie sich auch immer halten mag – als wahnhafte Projektion. Selbstverständlich klingt auch in den Werken der Tradition ein ›eurozentrisches‹ Gedankengut wider, das nicht zuletzt die gängige musiktheoretische Terminologie geprägt und beeinträchtigt hat. Der eintägige Workshop begibt sich hier auf eine kritische Spurensuche. Er legt kolonialistische und rassistische Gedankenfiguren in Texten der musiktheoretischen Tradition frei, um sie mit den dort verhandelten Werken in Beziehung zu setzten ...
Januar 2024
Musiktheorie und Zukunft
Publikation beim transcript-Verlag
»Statt qualitätssichernde Maßnahmen voranzutreiben, die letztlich die Auftrennung der Fächer und Disziplinen stillschweigend forcieren und somit eine auf Arbeitsteilung gründende Ökonomisierung von Wissensbeständen protegiert, könnte beispielsweise alternativ eine neue musiktheoretische Aussagenproduktion angestrebt werden, die beanspruchen würde, konventionelle Diskurseinteilungen in Fragezustellen und die mit ihnen verbundene Disziplinierung zu unterlaufen. Gemeint wäre beispielsweise das Vorhaben, eine fachspezifische, auf Verfahren künstlerischer Musikforschung ausgerichtete musiktheoretische Epistemologie zu betreiben, die gerade diejenigen Konfigurationen eines musikalischen Wissens in den Blick nimmt, die weder in den einzelnen musikalischen (musikpraktischen, künstlerischen) noch musikbezogenen (musikwissenschaftlichen, musikästhetischen) Disziplinen und Wissenschaften aufgehoben sind ...«
Weitere Informationen Aufsatz lesen
2023
November 2023
Barbarei der Arbeit
Seminar an der TAH Hamburg
›Arbeit‹ ist eine diffuse Kategorie. Wo fängt sie an, was markiert ihr Ende? Und wie sollte Arbeit ›angemessen‹ entlohnt werden? Welche Instanzen entscheiden über den Sinn von Arbeit, wer spricht ihr jegliche Berechtigung ab? Solche Fragen werden in künstlerischen Zusammenhängen in einer besonderen Weise relevant. Eine im Arbeitsbegriff selbst anthropologisch angelegte Spannung zwischen ökonomischer Reproduktion und ideeller Sinnstiftung wird hier wirksam, die in unlösbare Widersprüche führt. Das Seminar setzt Texte der philosophischen Arbeitstheorie mit aktuellen Symptomen der theatralen Kunstproduktion in Beziehung. Dabei soll es unter anderem darum gehen, nach zukunftsweisenden und nachhaltigen Formen künstlerischer Arbeit zu suchen, die bislang nur im Modus ihrer experimentellen Erprobung zugänglich sind …
Weitere Informationen Programm
November 2023
Über Bravheit
Vortrag im Rahmen der HfMT-Study-Weeks
›Brav‹ zu sein bedeutet, sich unaufgefordert an bestehende Regeln zu halten. Wer brav ist, gehorcht gerne und genießt den Schutz nicht weiter zu hinterfragender gesellschaftlicher Norm. Aktuell gerät die bürgerliche Kardinaltugend des Braven allerdings an eine brisante Schnittstelle. Einerseits werden Gehorsamkeitsregime auch im künstlerischen Bereich kontinuierlich ausgeweitet. Andererseits verlangt der Markt permanent nach zumindest simulierter Rebellion, um neue ›Alleinstellungsmerkmale‹ zu erschließen. Und wenn es so etwas wie eine These ist, die ich im Folgenden ausführen will, so ließe sich ihr Inhalt wie folgt zusammenfassen: Die spätmodernen, ordoliberalen, das heißt auf einer autoritären Durchsetzung und Ausweitung marktförmiger Systeme der Kontrolle und Selbstkontrolle westlicher Gesellschaften gewinnen zusehends Kohärenz aus einem »primär defensiven Weltverhältnis«, das mit der Bereitschaft zur weitestgehenden Anpassung an gegebene Verhältnisse einhergeht ...
Weitere Informationen Vortrag lesen
November 2023
Affekt und Bürgerlichkeit
Workshop beim Aktionstag ›Nähe und Distanz‹
Das Bürgertum hat ein gespaltenes Verhältnis zum Affekt. Einerseits sollen Affekte produktiv gemacht werden und in die Passform eines gelungenen Lebens eingetragen. Andererseits bedrohen Affekte den geregelten Verkehr von ›Reiz‹ und ›Reaktion‹: Sie lassen sich nur durch kalkulierte Strenge zügeln und koordinieren. Der Workshop lotet das Verhältnis von Affekt und Bürgerlichkeit praktisch wie theoretisch aus. In den Fokus gerät dabei eine kaum zu kontrollierende Beziehung von Nähe und Distanz, die ihr Gegenbild – zunehmend – in »bürgerlicher Kälte« (Kohpeiß 2023) findet.
November 2024
Klassismus als Institution
Moderation eines Podiums mit Francis Seeck
»Wir alle lieben die Vielfalt und wollen uns gerne mit ihr befassen, vergessen dabei aber gelegentlich, dass es sich bei Diversität immer auch und womöglich vor allem um ein ökonomisches Thema handelt, da gezeigt werden kann, dass Diskriminierung und soziale Ausgrenzung viel mit einer Ungleichverteilung finanzieller Ressourcen verbunden ist, womöglich sogar auf ihr basiert. [Karl Marx hat es als erster für uns ausbuchstabiert, viele andere folgten: der gesellschaftliche Hauptwiderspruch ist klassenbezogen und ökonomisch. Alle weiteren gesellschaftlichen Widersprüche sind Effekte ökonomischer Ungleichheit, in gewisser Weise deren ›Akzidenzien‹. Und hier ist die Sprache der Fakten tatsächlich alles andere als divers, eher erschreckend klar, »In Deutschland« ich zitiere aus einer aktuellen Publikation von Francis Seeck, Zitat, »verfügt das reichste Zehntel über 65 Prozent des Gesamtvermögens, während die untere Hälfte nur 1 Prozent des Gesamtvermögens besitzt. Von diesen unteren 50 Prozent [mit einem Prozent Gesamtvermögen] wiederum haben 20 Prozent überhaupt kein Vermögen oder sind sogar verschuldet ...«
Weitere Informationen
Oktober 2023
Einführung in geisteswissenschaftliches Grundvokabular
Theaterakademie Hamburg
Was sind Geisteswissenschaften und wozu sollte man sie heute (noch) betreiben? Worin liegt ihr ästhetisch-politischer Sinn? Wie lassen sich geisteswissenschaftliche Vorgehensweisen mit Fragen der Theaterpraxis verknüpfen? Solche Fragen versucht der Kurs im Rahmen eines kursorischen Überblicks geisteswissenschaftlicher Grundbegriffe aufzuwerfen. Dabei wird eine praxeologischeMethode verfolgt: Wir entwickeln gemeinsam ein ebenso vorläufiges wie flexibles geisteswissenschaftliches Grundvokabular aus einer Analyse des geisteswissenschaftlichen Aktes heraus, anstatt es diesem vorab in Form abstrakter Begriffe vorauszusetzen. Drei Fragen leiten uns dabei an: Wie kann ich eine adäquate geisteswissenschaftliche Forschungsfrage entwickeln (I. ›Denken‹)? Welche Methode wende ich an, um dieser Frage nachzugehen (II. ›Forschen‹)? In welcher Weise stelle ich die Ergebnisse meiner geisteswissenschaftlichen Forschungsarbeit abschließend schriftlich dar (III. ›Schreiben‹)? In Form eines Ausblicks kann dann abschließend noch darüber nachgedachgt werden, wie sich Geisteswissenschaft und Theater in Szenarien künstlerischer Forschung miteinander verbinden lassen.
…
Oktober 2023
Ästhetik des Hörens
Seminar an der HfMT Hamburg
Nie ist Hören bloßes Mittel zum Zweck. Stets bringt es eigene Wahrnehmungs- und Empfindungsweisen hervor, die ihm den Status eines eigenständigen und genuin ästhetischen Geschehens verleihen. Das Seminar setzt vor diesem Hintergrund philosophische Theorien des Hörens mit Beispielen aus der musikalischen Tradition in Beziehung, um auf diese Weise die Beziehungen von Musikästhetik und Gehörbildung kollaborativ zu evaluieren: Wie wäre eine aktuelle Theorie des Hörens verfasst, die für die musikalische Praxis anschlussfähig ist? Welche Herausforderungen an eine Methodik künstlerischer Musikforschung würden durch eine solche Praxis gestellt …?
Oktober 2023
Die Ökonomie der Diversität
Blockseminar im Rahmen der ›diversity-weeks‹
Diversity wird zumeist in identitätslogischen Kategorien verhandelt. Das, was verschieden ist, kann anhand unterschiedlicher ›Marker‹ (Geschlecht, Hautfarbe, soziale Herkunft) identifiziert und einer kritischen Auseinandersetzung zugänglich gemacht werden. Vernachlässigt wird in diesem Zusammenhang gelegentlich, dass diversity auch eine stark ökonomisch geprägte Dimension besitzt, die auf gängigen Identitätsbildungen vorausliegende gesellschaftliche Prozesse verweist. Politische Ungleichheit zeigt sich auch weiterhin und vor allem in einer ungleichen Verteilung ökonomischer Ressourcen, was im Musikbetrieb und seinen Ausbildungsinstanzen in einer besonderen Weise spürbar ist. Das Seminar versucht klassische ökonomische Theorien mit aktuellen Pathologien hochkultureller Kunstproduktion in Beziehung zu setzen …
September 2023
Musik und Klima, Katastrophe
Künstlerisches Forschungsseminar an der HfMT Hamburg (Dekanat 12)
Der Klimawandel hat den klassischen Musikbetrieb erreicht. Durch die drohende Vollkatastrophe mischen sich unüberhörbare Dissonanzen ins globale Konzert hochkultureller Musikproduktion. Wie viele Festspiele können wir uns noch leisten? Und was für Server gewährleisten den Genuss digitaler ‚concert-streams‘? Welche Mengen an Kerosin werden bei einer Asien-Tournee eines europäischen Spitzenorchesters in die Atmosphäre gepustet? Das Seminar geht den weit zurückreichenden Beziehungen von Musik und Klima nach. Dabei sollen aus dem musikalischen Material selbst Strategien skizziert werden, den Klimawandel ästhetisch nachhaltig zu bekämpfen …
September 2023
Ohnmacht der Heiterkeit
›Philosophische Interventionen‹ bei den Kulturtagen Hedersleben
»Es stimmt, dass sich die Philosophie nicht von einem Zorn gegen ihr Zeitalter trennen lässt [colère contre l’epoque], aber auch nicht von der Heiterkeit [sérénité], die sie uns verleiht. Die Philosophie ist keine Macht. Religion, Staat, Kapitalismus, Wissenschaft, Recht, öffentliche Meinung und Fernsehen sind Mächte, aber nicht die Philosophie. Die Philosophie kennt große innere Schlachten [batailles intérieurs] (Idealismus gegen Realismus etc.), aber das sind Schlachten, um zu lachen. Da, die Philosophie keine Macht ist kann sie auch nicht in eine Schlacht mit den Mächten eintreten, sie führt stattdessen einen Krieg ohne Schlacht gegen sie, eine Guerilla [guerre sans bataille]. Und sie kann nicht mit den Mächten sprechen, sie hat ihnen nichts zu sagen, nichts mitzuteilen, sie führt nur Unterhandlungen ...« (Gilles Deleuze, Pourparlers [1993])
Vortrag lesen
September 2023
Klassik und Klassenkampf
Beitrag für die ZWOELF
Classicus heißt auf Latein »zur ersten Steuerklasse gehörig« bzw. »mustergültig«. »Eine Leistung der Extraklasse« wird beispielsweise konstatiert oder »eine erstklassige Wahl« getroffen. Auch die ›klassische‹ Musik verspricht, reichhaltige Distinktionsgewinne einzufahren. Sie repräsentiert traditionelle Werte wie Fleiß, Genauigkeit und Durchhaltevermögen und ermöglicht ihren Konsument:innen auf diese Weise, sich vom gesellschaftlichen Einerlei abzuheben. Musik ist nicht nur ein ästhetisches, sondern vor allem auch ein soziales Phänomen. Musikalischer Geschmack entsteht dementsprechend nicht zufällig, er hängt eng mit dem Lebensstil beziehungsweise der Schichtzugehörigkeit zusammen, wie es beispielsweise der französische Soziologe Pierre Bourdieu in seinem Buch Die feinen Unterschiede gezeigt hat ...
Beitrag lesen
Juni 2023
Der Teufel und der Code
Ligetis Kritik der musikalischen Ökonomie
Gesetzmäßigkeiten fraktaler Geometrie, wie sie vom französisch-US-amerikanischen Mathematiker Benoît Mandelbrot (1923-2010) freigelegt und von György Ligeti kompositorisch aufgegriffen wurden, lassen sich nicht nur mit musikalischen Prozessen in Verbindung bringen. Sie sind auch für die Analyse wirtschaftlicher Krisen relevant, selbst wenn sich klassische ökonomische Theorien bis heute mehr oder weniger erfolgreich dagegen wehren. Der Beitrag setzt vor diesem Hintergrund Ligetis Études pour piano (1985–1994) spekulativ mit Entwicklungen auf den Finanzmärkten der 1980er und 90er Jahre in Beziehung, um von hier aus die politisch-ästhetische Aktualität von Ligetis kompositorischem Ansatz zu unterstreichen. ...
Juni 2023
Die Zwitschermaschine
Gastvortrag am IKM der Universität Potsdam
»Wir behaupten durchaus nicht, daß das Ritornell der Ursprung der Musik sei, oder daß die Musik mit ihm beginne. Es ist nicht gen au bekannt, wann die Musik begonnen hat. Das Ritornell ist eher ein Mittel, um Musik zu verhindem, abzuwehren oder loszuwerden. Aber die Musik existiert, weil auch das Ritornell existiert, weil die Musik das Ritornell aufnimmt, es sich als Inhalt in einer Ausdrucksform aneignet, weil sie einen Block mit ihm bildet und es fortträgt […] Die Musik unterwirft das Ritornell dieser besonderen Behandlung durch die Diagonale oder Transversale, sie reißt es aus seiner Territorialität heraus. Musik ist ein kreativer, aktiver Vorgang. der darin besteht. das Ritornell zu deterritorialisieren ...« (Gilles Deleuze / Félix Guattari, Tausend Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie II, S. 423.)
Vortrag lesen
April 2023
#awm (Alter Weißer Mann)
Seminar an der Theaterakademie der HfMT Hamburg
Das Patriarchat wankt. Zugleich scheint es über die rätselhafte Fähigkeit zu verfügen, sich immer wieder in Form bizarrer Widergänger zu erneuern. Seit geraumer Zeit wird dieser Umstand anhand der Gedankenfigur des »alten weißen Mannes« kritisch befragt, die darauf hinweisen möchte, dass eine Konzentration von Wissen, Macht und Kapital auch weiterhin an eine bestimmte Konfiguration von Geschlecht, Hautfarbe und Alter gekoppelt ist. Das Seminar geht dieser Gedankenfigur nach. Es versucht die Begriffsperson des alten weißen Mannes in der Literatur- und Philosophiegeschichte freizulegen und die Option einer dramatischen Attacke auf sie politisch-ästhetisch in Erwägung zu ziehen ...
März 2023
Bühne, Präsenz, Performance
Seminar im Dekanat 12 der HfMT Hamburg
Was ist künstlerische Präsenz? Und wie lässt sie sich auf einer Bühne wirkungsvoll aktualisieren? Wodurch wäre eine gelungene künstlerische Performance ausgezeichnet? Derartige Fragen haben seit der Corona-Krise eine neue Qualität angenommen. Sie verweisen auf eine zunehmende Integration digitaler Medien in den klassischen Konzert- und Theaterbetrieb und lassen die Schwierigkeit einer trennscharfen Unterscheidung von ›echter‹ und ›simulierter‹ Wirklichkeit in den Künsten greifbar werden. Dementsprechend fragt das Seminar nach den Möglichkeiten, zeitgemäße Formen der Bühnenpräsenz und Performativität ebenso theoretisch wie praktisch zu bestimmen …
März 2023
Imbalance
Konzert mit dem ensemble différance
Die Kompositionsgeschichte lässt sich immer auch als eine solche von Geschlechterkämpfen entziffern. Während der Klang an sich alle möglichen Formen geschlechtlicher Identitiät suggeriert und hörbar möglich werden lässt, war es über eine lange Zeit lediglich Männern vorbehalten, musikalische Kompositionen abschließend ins Werk zu setzen. Das Programm dieses Konzerts verfolgt Spuren, die in eine andere Richtung verweisen. Es erforscht Werke für Klaviertrio von vier Komponistinnen, die sich in je eigener Weise und zu historisch kontingentem Zeitpunkt mit den vorherrschenden Machtverhältnissen ihrer Zeit auseinandersetzen ...
Februar 2023
Verkommene Söhne, mißratene Töchter
Wissenschaftliches Begleitseminar an der Theaterakademie der HfMT Hamburg
»Die Jugend hat keine Welt, in der sie sich einrichten, kein Sein, in dem sie ruhen, kein Symbol, das sie repräsentieren kann. Dass sie sich im Geist und als Geist erkennt, heißt, dass ihr nichts mehr widerspricht als Natur, als das Unwissen und das Unbewusste der Gewöhnung und der Gewohnheit, des Soseins. Eine Jugend in der Knechtschaft, eine Jugend, die zur Welt gehört, zu den Abläufen und den Verhältnissen, zur Gesellschaft, ist ein Widerspruch, die Verwechslung einer geistigen mit einer natürlichen Größe. Deshalb denunziert die Metaphysik der Jugend den Reifeprozess, der die Jugend dem »Sein der Väter und Ahnen« zuführen soll, als Täuschung, Lüge, Ideologie.« (Alexander García Düttmann, Lob der Jugend)
2022
November 2022
50 Jahre Anti-Ödipus
Ein paradisziplinäres Symposium
Mehr als 100 Jahre ist es her, dass Rosa Luxemburg das logische und historische Ende des Kapitalismus prophezeit hat. Kein Haltbarkeitsdatum zwar, jedoch die folgende These: Hat die territoriale, imperiale, katastrophale Ausschöpfung des Globus erst einmal ihr obligates Ende erreicht – so argumentierte sie – wird der Kapitalismus ganz von alleine das Handtuch werfen müssen und gegen die Glaswände seiner verpestizierten Treibhäuser stoßen. Bis heute hat man davon jedoch noch nichts gesehen. Der Kapitalismus operiert auch weiterhin – rückblickend auf die Geschichte alter und im Angesicht neuer Krisen – als schizoider Grenzgänger, der bisher noch aus all seinen selbst hervorgebrachten Verwüstungen wie ein Phönix aus der Asche emporgestiegen ist ...
Oktober 2022
Werk, Widerstand, Kommunikation
Vortrag an der Kunstuniversität Graz
Als Virtuelles lässt das Werk kommunizieren. Es informiert, indem es im Zwischenraum von Notentext, Interpret_in und zuhandenem Instrumentarium ein Spiel dividuierender Kräfte freisetzt, das klangliche Mischungen aus sich entlässt. Darin ist ein Akt des Widerstands zumindest impliziert. ...
Oktober 2022
Idealismus der Struktur
Hohlfelds Erbe und Platons Schatten
Platons Höhlengleichnis simuliert nichts weniger als die Genese eines absoluten Wissens, das sich in den Bildern der Welt in vielfältiger Weise artikuliert, niemals jedoch relativiert. Der Grundstein der abendländischen épisteme ist gelegt, einer hierarchischen Wissensordnung, die uns heute bis in die letzten Fasern eines durchökonomisierten Wissenschaftsbetriebes verfolgt. Sind wir nicht alle Platoniker_innen geblieben, zumindest dann, wenn wir uns – mehr oder weniger freiwillig … dazu genötigt sehen zwischen ›Wahrheit‹ und ›Fälschung‹ zu unterscheiden?
Juni 2022
Les mots sont allés ...
Vortrag auf dem Abschiedssymposium für Michaela Ott
Der Ton ist bereits für sich Variation. Er kann nur als Variabilität auftauchen, worin sich nicht zuletzt seine Virtualität bemerkbar macht. Die in der Tonproduktion wirksamen Variablen sind daher auch im Fall von Les mots sont allés nicht als Akzidenzien einer ontologischen Tonsubstanz zu begreifen, die in bestimmter Weise präkonfiguriert vorliegen würden. Sie zeigen sich vielmehr als Ausdruck einer Virtualität des Tons, die sich artikuliert, indem sie die Instanzen seiner Produktion mehr oder weniger produktiv affiziert. Dadurch, dass die Cellist_in zugleich streicht, greift, vibriert, artikuliert etc. und auf diese Weise heterogene Bewegungsabläufe in einen mehr oder weniger ›diskordanten‹ Einklang versetzt, bringt sie den Ton nicht nur hervor. Sie folgt gleichzeitig seiner immanenten Logik, die darin besteht, sich aus Abständen zu generieren, die ihm zugleich eine differentielle Form der Kontinuität verleihen ...
Oktober 2022
Anti-Ödipus – A close reading
Lektürekurs an der Theaterakademie der HfMT Hamburg
»Das objektive Sein des Wunsches ist das Reale an sich. Eine besondere Existenzform, die psychologische Realität genannt werden könnte, existiert nicht. Wie Marx sagt, gibt es keinen Mangel, sondern nur die Leidenschaft als natürliches und sinnliches, gegenständliches Wesen. Nicht der Wunsch lehnt sich den Bedürfnissen an, vielmehr entstehen die Bedürfnisse aus dem Wunsch: es sind Gegen-Produkte im Realen, vom Wunsch erzeugt. Der Mangel ist ein Gegen-Effekt des Wunsches, ist abgelagert, vakuolisiert in der natürlichen und gesellschaftlichen Realität ...« (Gilles Deleuze/Félix Guattari, Anti-Ödipus. Kapitalismus und Schizophrenie, 1972)
Oktober 2022
Das postödipale Theater
Seminar an der Theaterakademie der HfMT Hamburg
Symbolische Ordnungen, die in ihrer Logik auf Aspekte des sogenannten Ödipus-Komplex zurückzuführen sind, so wie er von Sigmund Freud in seiner psychoanalytischen Theorie beschrieben wurde, scheinen ihre Ressourcen durchgebracht zu haben. Patriarchale Strukturen zerfallen, autoritäre Begehrlichkeiten brechen ein, um sich lediglich in Form ihrer bizarren Widergänger (Populismus, Sexismus, territorialer Größenwahn) am Leben zu halten. Folgt man der ›Ljubljaner Schule‹ rund um Theoretiker:innen wie Slavoj Žižek, Alenka Zupančič und Mladen Dolar, dann sind die westlich-kapitalistischen Gesellschaften seit geraumer Zeit dabei, in ein ›postödipales‹ Stadium einzutreten, in dem sich die Über-Ich-Struktur der Subjekte nicht länger entlang von Verboten herausbildet, sondern durch einen Imperativ geleitet wird, der uns in einer paradoxen Weise zu genießen heißt ...
September 2022
Schumann op. 129
Konzertante Erfahrung mit Orchester
Vielleicht bestand die überraschende Genialität von Schumann darin, eine Form zu entwickelt zu haben, die nur für die Schnelligkeits- und Langsamkeits-Verhältnisse geschaffen wurde, die materiell und emotional zugeordnet werden. In der Geschichte der Musik sind Formen und Motive immer wieder zeitlichen Transformationen, Steigerungen und Verringerungen, Verzögerungen und Beschleunigungen unterworfen worden, die nicht nur durch Organisations- oder gar Entwicklungsgesetze zustande kamen. In codierten Intervallen sind Mikro-Intervalle in Expansion oder Kontraktion wirksam ...
Juni 2022
gráphein. Für Hans-Joachim Lenger
Eine Anthologie, erschienen im Materialverlag
gráphein, das heißt nicht nur, zu ›schreiben‹. Es bedeutet auch, sich einer Differenz des »Sinns« auszusetzen, die alles Geschriebene, Gezeichnete und Gekerbte von Anfang an durchquert. Diese Anthologie geht dem gráphein nach, folgt seinen Spuren, um sie in künstlerischen, politischen und philosophischen Zusammenhängen freizulegen. Sie macht eine Auswahl vorrangig unveröffentlichter Texte von Hans-Joachim Lenger (1952–2019) zugänglich und verbindet sie mit Beiträgen von Autor_innen und Künstler_innen, die sich in unterschiedlicher Weise auf Lengers Denken beziehen. Die Frage nach einer sich selbst entzogenen Schriftlichkeit wird dabei ebenso virulent wie das ereignishafte Ineinandergreifen von Kunst, Philosophie und Gemeinschaft ...
Mai 2022
Die digitale Symbiose
Über immersive Bild- und Klangregime
Eine digitale Symbiose stellt eine eigenartige Mischform aus einer biologischen und psychologisch-gesellschaftlichen Verbindung dar, weil sie zum einen im Rahmen organischer Gegebenheiten (wie beispielsweise dem menschlichen Wahrnehmungsapparat) operiert und auf der anderen Seite auf anorganisch-technologische Zusammenhänge bezogen ist. Zudem ist sie wesentlich durch ökonomische, das heißt wertschöpfende Kräfte bestimmt, was ihr den Charakter opaker Hybridität verleiht. Die digitale Symbiose bewegt sich in einem Zwischenraum von ›Natur‹ und ›Technik‹, um ihre Differenz gleichzeitig unablässig zu unterwandern und in Frage zu stellen. Zudem ist die ihr innewohnende Hierarchie alles andere als klar, sondern mehrfach asymmetrisch ...
Juni 2022
Input zu Rheinberger
Vortrag beim KISS-Kolloquium
Hans-Jörg Rheinberger richtet sein Hauptaugenmerk zwar in allen seinen Texten auf die mehr oder weniger opaken, das heißt rätselhaften Strukturen des Experimentierens, die er, als habilitierter Molekularbiologe, durch genaue rekonstruktive Analysen der biowissenschaftlichen Laborarbeit erforscht. Im Gegensatz zum üblichen Selbstverständnis der forschenden Naturwissenschaften zeigt er allerdings durch eben diese Analysen auf, dass weniger Planung und Kontrolle, als vielmehr Improvisation und Zufall den experimentellen Forschungsalltag prägen. Ein Charakteristikum, durch das auch seine eigene Forschung unablässig affiziert wird ...
Mai 2022
Nähe und Distanz
Eine assoziative Radiomontage
»Mein Körper ist eine gnadenlose Topie. Und wenn ich nun das Glück hätte, mit ihm wie mit einem Schatten zu leben? Wie mit alltäglichen Dingen, die ich gar nicht mehr wahrnehme, weil das Leben sie hat eintönig werden lassen? Wie mit diesen Schornsteinen und Dächern, die sich abends vor meinem Fenster aneinanderreihen? Aber jeden Morgen dieselbe Erscheinung, dieselbe Verletzung. Vor meinen Augen zeichnet sich unausweichlich das Bild ab, das der Spiegel mir aufzwingt: mageres Gesicht, gebeugte Schultern, kurzsichtiger Blick, keine Haare mehr, wirklich nicht schön. Und in dieser hässlichen Schale meines Kopfes, in diesem Käfig, den ich nicht mag, muss ich mich nun zeigen. Durch dieses Gitter muss ich reden, blicken und mich ansehen lassen. In dieser Haut muss ich dahinvegetieren ...« (Michel Foucault)
April 2022
Redigieren, Kartographieren
Zu einer Formel Jean-François Lyotards
Zu ›redigieren‹, das bedeutet nicht nur, wie Jean-François Lyotard in seinem 1987 erschienenen Text »Die Moderne redigieren« deutlich macht, etwas ›in Ordnung zu bringen‹ oder ›durchzuarbeiten‹, beispielsweise ein vorliegendes Manuskript für eine bevorstehende wissenschaftliche Publikation. Zu Redigieren kann auch heißen, den Zeiger einer Uhr (lat. digitus) wieder auf null zurückzustellen, also zu re-digieren, um auf diese Weise, Zitat Lyotard, »reinen Tisch zu machen und auf einen Schlag eine neue Ära und eine neue Periodisierung einzuführen, die frei von jeglichen Vor-Urteilen ist.« Gemeint wäre eine Art von Rückkehr zu einem neuen Ausgangspunkt bzw. die Re-Konfiguration eines Anfangs, der alle bestehenden Voraussetzungen durchgestrichen hat und mit ihnen jede chronologische Linearität eines ›davor‹ oder ›danach‹ ...
...
April 2022
Anton und Anna
Von Nino Svireli
Nach einer Non Talking Cure bei seiner Analytikerin, die er mit minimalem wörtlichen Aufwand abgeschlossen hatte, entschloss sich Anton, Vater zu werden. In der Beziehung zu Anna gab es keine Veränderung, weder in der Qualität noch in der Quantität ihres Zusammenseins. In den Diskussionen, die sie selten, aber doch immer wieder miteinander führten, hatte sich keine zeitliche Perspektive für ein gemeinsames Kind eröffnet. Ein Kind, das Anton im Gegensatz zu Anna unbedingt wollte. Deshalb hatte Anton beschlossen, selbst Vater zu werden. Eine Vaterschaft, für die er von Anna schwanger werden würde. Anna war damit sofort einverstanden, da Anna nur noch den spendenden Teil leisten musste ...
April 2022
Das paradisziplinäre Paradigma
Anmerkungen zu einem Papier des Wissenschaftsrates
Wer sich in eine Lektüre der Empfehlungen zur postgradualen Qualifikationsphase an Kunst- und Musikhochschulen vertieft, die der deutsche Wissenschaftsrat im April 2021 auf Bitte der Kultusministerkonferenz veröffentlicht hat, den könnte stellenweise das Gefühl beschleichen, es handele sich bei der künstlerischen Forschung um ein schwer erziehbares Kind. Im ebenso wohlwollenden, wie besorgten, an wichtigen Schnittstellen aber auch schlicht ratlos wirkenden Ténor des Papiers, scheint die tiefgreifende Ambivalenz widerzuklingen, die der traditionelle Wissenschaftsbetrieb seinem jüngsten Geschwister gegenüber – der künstlerischen Forschung – seit dessen Geburt an den Tag gelegt hat. Diese Ambivalenz ist geprägt von einem Konflikt zwischen dem Festhalten an überkommenen Formen akademischer Wissensproduk-tion bei gleichzeitigem Zwang zu hochschulpolitischer Innovation ...
Aufsatz lesen
März 2022
Krieg und Musik – Analytische Perspektiven
Seminar an der HfMT Hamburg, Sommersemester 2022
Das Seminar fragt aus aktuellem Anlass nach der Rolle, die Musik in Kriegszeiten spielt, aber auch danach, inwiefern sich militärische Strategien in musikalischen Formen sedimentiert haben könnten. Leitend wird dabei die These des Medientheoretikers Friedrich A. Kittler, dass durch kriegerische Handlungen im Laufe der Geschichte immer wieder »übertragungstechnische Innovationen« forciert werden, die sich dann nach und nach auch in anderen gesellschaftlichen und kulturellen Sphären etablieren. Auf der Grundlage eines historischen Abrisses der Beziehungen von ›Krieg‹ und ›Musik‹ sollen im Seminar neben materialen Analysen und einzelnen Werkausschnitten auch aktuelle Phänomene der (digitalen) Popkultur diskutiert werden, die sich explizit gegen den Krieg und die von ihm ausgehende, zerstörerische Dynamik richten. (Photo von Peter Dammann)
März 2022
Die Kolonisierung der Zeit – Raum, Körper, Kapital
Seminar an der Theaterakademie der HfMT Hamburg
Die geläufige Hypothese, dass die weltweite Expansion des Kapitalismus in dem Moment an ihre immanente Grenze stoßen würde, in dem sie sich global etabliert hat und den gesamten Erdball umfasst, muss offensichtlich korrigiert werden. Denn auch, wenn aktuelle Imperialismen an traditionellen Formen territorialer Ausweitung festhalten, sind sie doch insgesamt in ein neues Stadium eingetreten, das weniger einer extensionalen Logik des Raums, als einer intensiven Dynamik der Zeit zu gehorchen scheint. Das Seminar fragt hier nach Möglichkeiten von ästhetischer Unterbrechung und künstlerischer Intervention, wobei das aktuelle Ineinanderspiel von ›Raum‹, ›Körper‹ und ›Kapital‹ ebenso thematisch wird, wie eine unlängst von Joseph Vogl vorgeschlagene »Artistik des Schwarzmalens« ...
März 2022
Virtuelle Mehrstimmigkeit
Bachs Suiten für Violoncello solo als Gegenstand künstlerischer Forschung
Johann Sebastian Bachs Suiten für Violoncello solo BWV 1007-1012 gehören zum Kernbestand cellistischer Praxis, wovon unzählige Werkausgaben, Interpretationen und Aufnahmen zeugen. In kompositionstechnischer Hinsicht verweisen die Werke jedoch auf ein ›Problem‹. Um sein mehrstimmiges Konzept auf ein einstimmiges Melodieinstrument zu übertragen, muss Bach den ihm geläufigen musikalischen Satz komprimieren, reduzieren bzw. fragmentarisieren. So manch eine, harmonisch stützende oder kontrapunktisch kommentierende Stimme fällt dabei ›unter den Tisch‹: sie ist nur noch gedanklich zu erahnen und wird in eigentümlicher Weise ästhetisch ›virtuell‹. Das Forschungsvorhaben fragt nach den Möglichkeiten, ein mehrstimmiges Satzbild der Cellosuiten mithilfe von Generalbass und Kontrapunkt zu rekonstruieren ...
März 2022
Was ist Zeit?
Augustinus: Confessiones (gelesen von Sabine Kastius)
»Denke Dir: eine körperliche Stimme hebt an zu ertönen und tönt und tönt, und mit einemmal hört sie auf, und nun ist es still, und die Stimme ist vergangen und es ›ist‹ keine Stimme mehr. Sie war künftig, bevor sie ertönte, und man konnte sie gar nicht messen, weil sie nicht mehr ›ist‹. Also nur während sie erklang, konnte man sie messen, denn da ›war‹ was gemessen werden konnte. Aber auch da stand sie nicht unbewegt; sie ging und verging. Konnte sie gerade deshalb gemessen werden? Denn nur während sie vorüberging, dehnte sie sich zu einer gewissen Dauer aus, so dass sie eben hieran zu messen war, da ja Gegenwart als solche keine Ausdehnung hat.« (Confessiones, Buch XI)
Februar 2022
Crisis, Cliché – Notes on the State of Emergency
Lecture at the UAL Philosophy Society, London
‘Cliché’ and ‘Crisis’ are closely related in the history of the arts. On the one hand, artistic practices notoriously approach clichés in order to enter into an aesthetic game of difference and repetition with them. On the other hand, they are involved in an incessant struggle against the cliché, which seeks to break with predetermined formats in order to turn to the new and the unknown. The cliché thus regularly plunges art into a deep crisis, from which new clichés are likewise constantly emerging. The lecture attempts to relate this interplay to the current political situation in which cliché and crisis have become a kind of ‘zone of indistinguishability’. States of exception become the rule, while the succession of crisis-like situations acquires a certain form of predictability. What does this mean for political reality? What artistic practices could adequately intervene here?
Januar 2022
Fluchtlinien der Konsistenz
Vortrag bei der Ausstellung licht fuge lehm
Das metaphysische Kalkül eines philosophisch konstruierten ›Dezimalsystems‹, das uns heute bis in die tiefsten Schichten einer digital ausdifferenzierten Praxis unablässiger Selbstkontrolle verfolgt, wird in der Installation licht fuge lehm den Kräften einer gewissen Unberechenbarkeit ausgesetzt. Die symmetrisch geordnete Figur der Tetraktýs wird hier nämlich kurzerhand auseinandermontiert und in die Arena des ungenutzten Schwimmbeckens hineingezogen. Die geometrische Figur kommt auf diese Weise, wenn man so will, auf dem ›Boden der Tatsachen an. Sie wird experimentell verräumlicht und auf diese Weise fragmentarisiert. Ziegelartige Figuren aus Lehm, sowie durch Röhren hervorgerufene Lichteffekte lassen auf dem trockengelegten Grund des Beckens gewisse Reste geometrischer Ordnungen auftauchen, deren allegorische Zerstreuung ein sinnvolles Ineinandergreifen von Chaos und Ordnung in Aussicht stellt ...
2021
Dezember 2021
Flétrir [Verblühen]
Konzert anlässlich des 100. Todestages von Camille Saint-Saëns
Am 16. Dezember 1921 stirbt Camille Saint-Saëns mit 86 Jahren im Hotel de l´Oasis in Algier. Es ist 22:30 Uhr. Da er Träger des Großkreuzes der Ehrenlegion ist, werden die Musiker des Opernhauses aus dem Schlaf gerissen, Soldaten aus den Kasernen abkommandiert, um den Leichnam des Komponisten zur Kathedrale zu geleiten. Dort erklingt spontan Saint-Saëns Ave verum und der »Schwan« aus dem Karneval der Tiere. Aller Ehrungen zum Trotz ist sein Ruhm in Frankreich zu dieser Zeit bereits verblüht, seine Musiksprache gilt vielen als überholt. Camille Saint-Saëns’ Klaviertrio No. 2 e-moll op. 92 bringt dementsprechend eine Doppelbewegung zum Ausdruck. 1892 in Algier entstanden, verweist es sowohl auf zukünftige musikalische Entwicklungen, wie es Leitmotive aus Saint-Saëns’ bisherigen Schaffen zusammenfasst ...
Dezember 2021
Paradoxien des Online-Musikunterichts
Vortrag beim Aktionstag der HfMT Hamburg
Medien vergisst man in der Regel, wenn sie funktionieren, und sie werden auffällig, wenn etwas nicht klappt. Und so konnte während der letzten 20 Monate immer wieder die Erfahrung gemacht werden, dass in der als allmächtig erscheinenden digitalen Maschinerie Genie und Wahnsinn nah beieinander liegen. Wer kennt sie nicht, die technischen Unwägbarkeiten eines Online-Seminars oder die kleinen, fast perfiden Katastrophen, die sich während eines digitalen Bewerbungsgespräches ereignen können. »The medium ist the message« konstatierte der US-amerikanische Medientheoretiker Marshall McLuhan. Es fiel in der letzten Zeit manchmal schwer, diese berühmte Formel nicht auf sich selbst zu beziehen, da einem der eigene Computer oft genug den Eindruck vermittelte, dass er einen nicht ausstehen kann ...
November 2021
Kritik und Musik
Workshop mit Iris Dankemeyer an der HfMT Hamburg
An René Leibowitz schrieb Adorno, die Tatsache, dass er nicht mehr komponieren konnte, bilde »in meiner ganzen Existenz ein Trauma«. Denn aus dem Wunderkind Teddie Wiesengrund wurde schließlich nur ein berühmter Philosophieprofessor. Aber Adorno hatte auch ein Leben fern von Frankfurt. Überall war Adorno ein anderer – in Wien genoß er das Künstlerleben als kapriziöser Kompositionsschüler, in New York wurde er musikalischer Direktor der ersten marktwirtschaftlichen Studie zum Radiokonsum und damit ein frustrierter Sozialforscher. In Los Angeles transponierte er den künstlerischen Ausdruckswillen in die philosophische Schreibarbeit und in Darmstadt kehrt er noch einmal kurz in komponistische Kreise zurück. Bis an sein Lebensende hielt Adorno daran fest, »daß ich nämlich ein Komponist bin, quand même«. Soviel steht fest: In Adornos Biografie gehören Musik und Kritik unzertrennlich zusammen ...
Oktober 2021
Adorno und die musikalische Analyse
Seminar an der HfMT Hamburg, Wintersemester 2021/22
Während sich aktuelle Musikästhetiken vor allem mit Aspekten musikalischer Erfahrung befassen, ist die Musikphilosophie Theodor W. Adornos dezidiert als Werkästhetik angelegt: Sie fragt nach der kompositorischen Verfassung musikalischer Kunstwerke, um sie als Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse zu interpretieren. Der musikalischen Analyse kommt in diesem Zusammenhang eine zentrale Stellung zu. Sie ist bei Adorno sowohl Reflexionsmedium als auch Vollzugsform einer ihr übergeordneten Gesellschaftskritik, die ihre Motivation aus den zu untersuchenden Werken gewinnt. Das Seminar fragt nach der Aktualität eines derartigen Vorhabens. Ins Zentrum rückt dabei unter anderem die Frage, auf welche Weise sich ›Werk‹ und ›Aufführung‹, ›Notentext‹ und ›Interpretation‹ im Zeitalter digitaler Reproduktionstechnologien überhaupt noch sinnvoll voneinander unterscheiden lassen ...
Oktober 2021
Alles fließt – Aber wohin?
Beitrag für das Hochschulmagazin zwoelf der HfMT Hamburg
Dass die Welt in einem Prozess unablässiger Veränderung begriffen ist, gehört wohl zu den ersten vagen Verallgemeinerungen, die die menschliche Intuition hervorgebracht hat. Sie klingt nicht nur in einigen der schönsten hebräischen Psalmen des Alten Testaments wider. Sie findet auch in der berühmten Formel des Heraklit von Ephesos einen ersten philosophischen Ausdruck: »πάντα ῥεῖ – Alles fließt.« Seit Heraklit durch seinen Aphorismus vor 2500 Jahren die sogenannte Prozessphilosophie begründet hat, ist viel Wasser den Strom der Geschichte heruntergeflossen. Die Welt hat sich verändert und mit ihr die Auffassung darüber, wie der universelle ›Flow‹ des Weltganzen zu begreifen sei. So ziert die Wendung ›Panta Rhei‹ heute Werbebroschüren für Wellness-Oasen und Coaching-Angebote, um auf diese Weise gewisse Ökonomien der Selbstfindung am Laufen zu halten. Manchmal macht sie auch einfach nur wie ein Stoßseufzer die Runde. Sie wird zum resignativen Wahlspruch einer fast vollständig globalisierten Welt, die den permanenten Wandel zu ihrem Alleinstellungsmerkmal erklärt. In der Alltagssprache begegnet uns der Begriff Prozess dementsprechend allenthalben, ohne dadurch besonders aussagekräftig zu sein. Er soll offensichtlich all das unter sich versammeln, was in irgendeiner Form der Veränderung begriffen ist. In therapeutische Prozesse lässt sich ebenso eintreten wie in diejenigen beruflicher Weiterentwicklung und Kreativität. Gelegentlich erscheint die Aussage »Wir befinden uns in einem Prozess!« aber auch einfach nur wie das ebenso erwünschte wie schlichte Hinauszögern der Artikulation eines Gedankens ...
Oktober 2021
High Noon
Weltmusik, zusammen mit Lorenz Schmidt (Handpan)
Eine Handpan verfügt über eine aus zwei miteinander verklebten Halblinsensegmenten bestehende Grundform, einem zentralen Tonfeld und einem Ring aus mindestens sieben Tonfeldern auf der Oberseite und einer Öffnung auf der Unterseite. Für die Rohform kommen unterschiedliche Stahlblechsorten, Blechstärken und Herstellungsverfahren zum Einsatz. Anzahl, Größe und Form der Tonfelder sowie die zur Ausformung der Tonfelder angewandten Techniken unterscheiden sich allerdings. Die Tonfelder der meisten Handpans weisen in der Mitte der Tonfelder eine nach innen gerichtete Einwölbung auf, für die sich im Englischen der Ausdruck Dimple [Beule] durchgesetzt hat. Hier gibt es erhebliche Variationen in Größe und Form. Während das ›Ding‹ genannte, zentrale Tonfeld des Vorläufers Hang eine nach außen gewölbte Kuppel aufweist, kommen bei den Handpans oft auch zentrale Tonfelder mit nach innen gerichtetem Dimple analog zu den Tonfeldern im Kreis vor ...
September 2021
Resonanzen Enescus
Konzert in Leipzig, zusammen mit Alexandra Bartoi
Im Paris des ›Fin de siecle‹ versammelt sich nicht nur eine musikalische Elite, um die Weichen für eine stilistisch vielfältige musikalische Zukunft zu stellen. Auch in literarischer, philosophischer und kinematografischer Hinsicht bildet die französische Hauptstadt ein Zentrum Europas, von dem ausgehend wichtige Impulse für die künstlerische Entwicklung des 20. Jahrhunderts Raum greifen. In diesem überaus produktiven Milieu erforschte George Enescu von 1895–99 seine kompositorischen Möglichkeiten, die er zusammen mit seinem Kommilitonen Maurice Ravel und seinen Lehrern Gabriel Fauré, Claude Debussy und Camille Saint-Säens ausgelotet hat. Das Konzertprogramm versucht den Resonanzen nachzugehen, die aus dieser produktiven ästhetischen Konstellation hervorgegangen sind. Neben Originalkompositionen für Violine und Violoncello von George Enescu und Maurice Ravel erklingen Arrangements von Claude Debussy, Gabriel Fauré und Camille Saint-Säens, um sie zeitgleich entstandenen Werken wie den rumänischen Tänzen von Béla Bartók gegenüberzustellen. Auf diese Weise sollen ästhetische Berührungspunkte ebenso deutlich gemacht werden, wie die unterschiedlichen Richtungen, in die ein gemeinsamer Ausgangspunkt führen kann. Der Konzertort des Kinosaals UT Connewitz wird dabei zusätzlich zum Anlass genommen, auch aus philosophischer Sicht über die Verteilung musikalischer Klang-Bilder (images-sonores) nachzudenken, wie sie sich in den unterschiedlichen Werken anordnen, überlagern und kommentieren.
September 2021
Bach in Frankreich
Aufnahmen in Mons la Trivalle
Mons oder Mons-la-Trivalle (okzitanisch Mònts) ist eine französische Gemeinde im Departement Hérault in der Region Occitanie. Sie befindet sich im Kanton Saint-Pons-de-Thomières und hat 605 Einwohner. Mons liegt am Zusammenfluss der Täler Orb und Jaur, südlich des Espinouse-Massivs, im Herzen des regionalen Naturparks Haut-Languedoc, am Fuße des Berges Caroux und am Eingang zu den Héric-Schluchten. Zahlreiche Wanderwege ermöglichen es, verschiedene Aussichtspunkte zu entdecken, vom Orientierungsplateau von Caroux sind das Mittelmeer und die Pyrenäen sichtbar. Seine Felsen, die auf den Süden des Languedoc hinweisen bieten der kanariengelben Sonne ihre seltene Schönheit. Im Jahr 2020 wird die Gemeinde in der von Météo-France erstellten Klassifizierung, die fünf große Klimatypen auf dem französischen Festland umfasst, als ›mediterran‹ eingestuft. Für diese Art von Klima sind die Winter mild und die Sommer heiß, mit viel Sonnenschein und häufig heftigen Winden ...
August 2021
Jean-Luc Nancy (1940–2021): Gott, Charlie, Niemand
Gelesen von Markus Boysen
Der Name ›Gott‹ ist nicht der Name einer bestimmten Gestalt. Und das ist der Grund dafür, dass der einzige und alleinige Gott des Monotheismus, in all seinen Versionen, nicht abgebildet werden kann. Die Gottesbilder sind zuvorderst nicht verboten: sie sind vor allem unmöglich. Selbst dort, wo sie nicht ausdrücklich verboten sind, wissen die Gläubigen sehr wohl, dass diese Bilder nicht Gott sind. Dies gilt selbst dann noch, wenn man den Bildern einen sakralen Wert zugesteht – wie den Ikonen des orthodoxen Christentums. ›Gott‹ ist dafür nur der gemeinsame Name. ›Gott‹ oder ›ein Gott‹ wird verwendet, um auf das aufmerksam zu machen (anstatt zu bezeichnen), was sich jedem Namen entzieht, das, was unnennbar ist ...
August 2021
Am Saum des Sinns [aR15]
Irrwege und Umwege zu Jean-Luc Nancy
»Ganz Ohr sein, lauschen, das ist immer am Saum des Sinnes sein, oder in einem Rand- und Außensinn, und als wäre der Klang eben nichts anderes als dieser Saum, diese Borte oder dieser Rand – zumindest der musikalisch gehörte Klang.« Diese Zeilen aus Jean-Luc Nancy's Essay Zum Gehör machten wir uns im Team von agoRadio im Mai 2015 zum Ausgangspunkt einer radiophonen Recherche, die sich einer akustischen Phänomenologie des philosophischen Sinns widmete. Aus ebenso aktuellem wie traurigen Anlass – Jean-Luc Nancy ist am 23. August 2021 gestorben – kann sie nun hier noch einmal nachgehört werden ...
Weitere Informationen Über agoRadio
Juni 2021
Zorn und Heiterkeit
Vortrag bei der Ringvorlesung »Farewell – A Million Ways to Say Goodbye«
Während der Corona-Pandemie lässt sich der Eindruck kaum vermeiden, dass es zwischen ›Philosophie‹ und ›Politik‹ – zumindest in Deutschland – zu einer einvernehmlichen Trennung gekommen ist: man hat sich nicht mehr wirklich viel zu sagen. Erkennbare Impulse beispielsweise, die Stimme der philosophischen Reflexion in die abendfüllenden Debatten im Berliner Kanzler*innenamt mit aufzunehmen blieben aus. Und auch wenn sich auf der Ebene verschiedener Blogs, Podcasts und sonstiger Online-Formate eine bunte Vielfalt philosophischer Ausdeutungen der Krise artikuliert: philosophische Veröffentlichungen zum Thema, denen es gelingt sich an die Oberfläche einer ›breiteren‹ Öffentlichkeit durchzuschlagen, sind eher die Seltenheit. Das einzige Buch, das ebenso tiefgreifend, wie schnell auf die Krise reagierte und vor allem ihre ökonomischen Konsequenzen analysierte kam bezeichnender Weise nicht von einer Philosoph*in, sondern von einem Literaturwissenschaftler: Joseph Vogls Studie Kapital und Ressentiment. Eine kurze Theorie der Gegenwart. Auch wenn diese Auflistung von Buchtiteln eine gewisse Themenvielfalt suggeriert, ist die publizistische Ausbeute bei einer derart breit aufgestellten akademischen Disziplin wie der Philosophie eher überschaubar. Ihre meisten Vertreter*innen hüllten und hüllen sich auch in dieser politischen Debatte – wie so häufig – in bedeutungsvolles Schweigen, um weiter ihren regulären Forschungen nachzugehen. Macht sich hierin eine spezifische Form der ›Machtlosigkeit‹ der Philosophie bemerkbar?
Juni 2021
Debussy: Sonate pour violoncelle et piano [1915]
Konzert in Hamburg
1915, drei Jahre vor seinem Tod, begann Debussy einen Zyklus von Six sonates pour divers instruments, die er in bewusster Anlehnung an die französische Sonatenkunst des Barock konzipierte. Von den geplanten sechs Sonaten konnte er nur noch drei vollenden: die Cellosonate, die Violinsonate und die Sonate für Flöte, Viola und Harfe. Auf dem Titelblatt der drei Sonaten, die der Verleger Durand publizierte, nannte sich der Komponist selbstbewusst: Claude Debussy. Musicien français. Der nationale Zusatz verlieh dem Selbstverständnis des Komponisten in zweifacher Hinsicht Ausdruck: zum einen politisch im Sinne eines guten Patrioten, der die »Austro-Boches« im Ersten Weltkrieg »auf dem letzten Loch pfeifen« sehen wollte, zum anderen musikalisch im Sinne eines bewusst französisch empfindenden Musikers ...
Mai 2021
Klischee, Chaos, Virtualität
Gastvortrag an der Akademie der bildenden Künste Wien
Auf Francis Bacons Bild Figure standing at a washbassin von 1976 sieht man eine gestauchte Figur, die sich über einem Waschbecken krümmt, dessen Abflussrohr eine runde Arena eröffnet. Sie ragt ebenso ins bildliche ›Off‹ hinein, wie sie in den monochromen Hintergrund zu führen scheint, in den die Figur offensichtlich entfliehen möchte. Die dynamische Gesamtbewegung des Gemäldes, sein zeitlicher Prozess, drängt in die Abflussöffnung des Waschbeckens hinein, aus der kinetische Energie zugleich zurückwirkt: Die Öffnung ist zu klein, als dass sie einen Ausweg ermöglichen würde. Die von Bacon geschaffene Figur kann nicht von der Bühne ihrer malerischen Repräsentation verschwinden, weil die Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind ...
Mai 2021
Zukunft ohne Horizont?
Vortrag bei der Tagung ›Musik/-Theorie und Zukunft‹
Als Joint wird im Englischen u.a. ein kleiner metallener Stift bezeichnet, der, in einen Griffpunkt gelegt, eine stabile Drehbewegung von Türen und Fenstern ermöglicht. Im Deutschen sagt man hierzu eher Angel als ›Fuge‹, was vom althochdeutschen Begriff angul für Haken abgeleitet ist. Solange die Zeit in ihren ›Angeln‹ eingehakt bleibt, ist sie, antiken Konzeptionen zufolge, der extensiven Bewegung der Welt untergeordnet. Sie erscheint gemäß Aristoteles berühmter Formulierung als deren Maß, Intervall oder Zahl. Befreit sich die Tür der Zeit jedoch aus ihrer Verankerung – wie Hamlet konstatiert – lässt das nicht nur die Bewegungen der Welt aus dem Ruder laufen. Die Zeit selbst hat ihren Ursprung verloren, ihren Angelpunkt, um von nun an lediglich relative Maßstäbe der Bewegungsdurchmessung zu stiften. Im Gegenzug bringt sie ihre eigenen und irregulären Bewegungen hervor, die keinen vorgezeichneten Bahnen mehr folgen. Hamlets Formel von einer aus den Angeln gehobenen Zeit resoniert unter anderem in der Zeitphilosophie Immanuel Kants, die in zeitlicher Nähe zu Mozarts Dissonanzenquartett entstanden ist ...
April 2021
Promenaden des Schizophrenen
Anmerkungen zur Hamburger Ausgangssperre
»Zweifellos kann ich den Tag auch dazu nutzen, um zu Hause zu bleiben; oder ich kann zu Hause bleiben dank eines anderen Möglichen (›es ist Nacht‹). Aber stets erfolgt die Verwirklichung des Möglichen durch Ausschließung, denn sie setzt Vorlieben und Ziele voraus, die variieren und immer die vorhergehenden ersetzen. Es sind diese Variationen, diese Substitutionen, all diese ausschließenden Disjunktionen (Nachtdunkel – Tageshelle, ausgehen – heimkehren), die auf die Dauer ermüden.« (Gilles Deleuze, Erschöpft)
März 2021
Noten zum Klang-Bild
Publikation beim transcript-Verlag
Ein Notentext bildet den Klang lediglich auf Umwegen ab. Er enthält vor allem Informationen darüber bereit, was in einer Komposition potentiell an Klang ›vorhanden‹ ist bzw. was durch eine Aufführung zu Gehör gebracht werden könnte. Diese Vorhandenheit des Klangs im Notentext ist allerdings in einer eigentümlichen Weise virtuell. Nicht verzeichnete oder auch gar nicht im Rahmen seiner Systematik verzeichenbare Parameter wie Klangfarbe, klangliche Intensität, Agogik etc. gehören ebenfalls zum klanglichen Potential des Notentextes, wie die Parameter, auf die explizit verwiesen wird. Die schriftliche Notation des Prélude ist somit implizit und explizit zugleich. Sie trägt Züge einer opaken Informationsfläche, die nach einer bestimmten Form ›sonifizierender‹ Lektüre verlangt. Der Cellist ›liest‹ den Notentext, indem er dem ihm zur Verfügung stehenden Instrumentarium konkrete musikalische Bewegungen zufügt. Das lässt einen konventionellen Textbegriff brüchig werden. Im Sinne der Bedeutung des lateinischen Wortes textum muss ein Notentext immer auch als ›Gewebe‹ virtueller Beziehungen von Bild und Schrift, Zeit und Bewegung verstanden werden, die dazu herauszufordern, in einer singulären Weise klanglich aktualisiert zu werden ...
März 2021
Bach: Suite für Violoncello solo
c-moll BWV 1011
Konzert in Hamburg
Die Entstehung der Suite für Violoncello solo c-moll BWV 1011 fällt in eine Zeit, in der ein tragisches Ereignis Bachs Leben aus den Fugen geraten ließ: der unerwartete Tod seiner ersten Frau Maria Barbara im Jahr 1720, mit der er fünf gemeinsame Kinder im Alter von vier bis elf Jahren hatte. Der Bericht des Nekrologs fällt der damaligen Zeit entsprechend nüchtern aus: »Nachdem er mit dieser seiner ersten Ehegattin 13 Jahre eine vergnügte Ehe geführet hatte, wiederfuhr ihm […] der empfindliche Schmerz, dieselbe bey seiner Rückkunft von einer Reise, […] todt und begraben zu finden ohngeachtet er sie bey der Abreise gesund und frisch verlassen hatte. Die erste Nachricht, dass Sie krank gewesen und gestorben wäre, erhielt er beym Eintritte in sein Hauß.« Zwar bleibt eine direkte Verknüpfung der c-moll-Suite mit dem unvorbereiteten Schicksalsschlag eine Spekulation. Der Autograph der Suite ist verschollen und ihre Entstehungszeit lässt sich nur in etwa um das besagte Jahr 1720 datieren. Die in der Suite zu vernehmenden Affektladungen lassen jedoch vermuten, dass es sich bei der Komposition um eine musikalische Auseinandersetzung mit dem Tod und der Trauer handelt. Besonders in der ›Allemande‹ überlagern sich klagende und niedergeschlagene Klanggesten mit solchen des Trotzes und der hochfahrenden Ostentation ...
März 2021
Die musikalische Interpretation im Zeitalter ihrer digitalen Reproduzierbarkeit
Seminar an der HfMT Hamburg, Sommersemester 2021
Digitale Technologien sind seit geraumer Zeit dabei, ihren Einflussbereich auf die Praxis musikalischer Interpretation auszuweiten. Sei es einaussagekräftiges Artist-Profil bei Instagram, seien es innovative Education-Formate auf Youtube oder das Live-Streaming von Konzerten in der Digital Concerthall – ohne Zugang zu digitalen Medien scheint eine Beteiligung am klassischen Konzertbetrieb zunehmend undenkbar zu sein. Durch die Corona-Pandemie hat sich diese Situation ökonomisch verschärft: in die Taten- und Belanglosigkeit verbannt, stellt eine digitale Interpretationspraxis fürklassische Musiker*innen oftmals die einzige Möglichkeit dar, überhaupt noch an einem virtualisierten Konzertbetrieb zu partizipieren ...
Februar 2021
Hindemith: Solosonate op. 25/3
Lockdown Session
Der 1. Satz der Solosonate op. 25/3 von Paul Hindemith, komponiert 1922 ist bi-tonal verfasst, d.h. es kommt zu einer simultanen Schichtung verschiedener Tonfelder ohne klar definiertes harmonisches Zentrum. Gleich am Anfang wird ein C-Dur Akkord unvermittelt in einen Cis-Dur Akkord umgebogen. Das reflexhaft folgende e versucht diesen ›Unfall‹ zu korrigieren, kommt als nachgereichte Terz des zuvor missratenden C-Dur-Akkordes allerdings zu spät, rutscht in ein es ab, das nun in kürzester Folge mit c-moll schon die dritte Tonart suggeriert. Über einen c-moll-Septakkord, der zum verminderten Septakkord auf Es mutiert, wird unvermittelt eine D-Ebene eingezogen, die nach Es und von dort nach E taumelt. Zwar ist eine steigende chromatische Bewegung als harmonische Folie noch erkennbar. Doch akkumuliert die musikalische Bewegung schnell eine unüberblickbare Fülle von Anschlussmöglichkeiten und uneingelöster Erwartungen ...
Februar 2021
Portrait und Farbe
Essay zu Bergson und Deleuze in neuem Textlayout
Die Gegenwart ist Bergson zufolge niemals ›bei sich‹, sondern zeigt sich vielmehr als »reines Werden, das immer außer sich ist.« Das Gegenwärtige war daher in jedem Augenblick schon, weil es unfassbar schnell voranschreitet. Von der Vergangenheit kann man hingegen nicht sagen, dass sie war. Sie »insistiert, sie besteht, sie ist«, weil sie zusammen mit jeder aktuellen oder neuen Gegenwart koexistiert. Vor diesem Hintergrund ist auch Bergsons zentrale These zu verstehen, dass die Vergangenheit nicht gespeichert werden muss, weil sie sich an sich erhält. Sie konstituiert sich nicht erst, nachdem sie Gegenwart gewesen ist, sondern existiert unabhängig und vor jeder Gegenwart. Es bereitet zunächst Schwierigkeiten sich ein solches »Überleben der Vergangenheit in sich selbst« vorzustellen, weil der psychologischen Wahrnehmung der Gegenwart widerspricht ...
Januar 2021
Affekt und Kontrolle
Von Mareike Teigeler
»Aufgrund der differenziellen Eigenart der Kontrolle, findet Funktionieren zunächst, ganz gleich, ob es an eine globale Strategie gebunden ist, die es auf seine Effizienz, auf seine ökonomische Nutzbarmachung hin wahrnehmbar werden lässt, oder, ob es einen emanzipatorischen Entwurf im Sinne eines Anderswerdens darstellt im Bereich des Virtuellen statt. Kontrolle agiert darüber, das freie Spiel der Kräfte in seiner ereignishaften Form an ein Bedürfnis nach eigener Leistungsfähigkeit zu binden, durch das die Kräfte und Affekte in einer bestimmten Art und Weise aktualisiert werden. Kontrolle lässt vielfältige Formen des affektiven Funktionierens zu bzw. inszeniert diese, indem mit diesen das gleichzeitige subjektive Bedürfnis korrespondiert, sich zu optimieren. Die subjektive Bewandtnis wird durch die ereignishaften Arrangements also nicht aufgelöst oder überschritten, sondern an ein freiheitliches Aussehen gebunden, das Selbstbestimmung verspricht. Subversion lässt sich demnach nicht als Ausspielen affektiver Kräfte gegen vorgegebene Formen der Subjektivierung bezeichnen, sondern muss als Ausspielen dieser Kräfte gegen die eigene Selbstinszenierung derselben verstanden werden.« (Mareike Teigeler)
Januar 2021
Wandern, Wuchern, Werden
Gastbeitrag im Seminar von Pepe Danquart
Das Konzept der balade (von frz. »balader« für ›Umherschweifen‹, ›Fahrt aufnehmen‹, ›Bummeln‹) taucht in Gilles Deleuzes Filmphilosophie an einem neuralgischen Punkt auf, an dem sich die beiden Flügel seiner Kino-Studie Das Bewegungs-Bild und Das Zeit-Bild ebenso voneinander trennen, wie sie in intensiveren Kontakt geraten. Deleuzes Diagnose zufolge unterscheidet sich das moderne Nachkriegskino vor allem dadurch vom klassischen Hollywoodfilm, als es »die Fahrt, das Herumstreifen [balade] und das ständige Hin und Her« an die Stelle der »gezielten Aktion oder einer sensomotorischen Situation« treten lässt, was die filmischen Ereignisse zunehmend unbedeutender, ihre Verkettung schwächer bzw. zufälliger macht. Die Straße wird in diesem Zusammenhang zu einem »beliebigen Ort«, der virtuelle Fluchtbewegungen ebenso möglich macht, wie er ihre klischeehafte Linearisierung ästhetisch asphaltiert ...
2020
Dezember 2020
Bach: Gavotte BWV 1011
Homerecording
Dem Köthener Kapellmeister und Director derer Cammer-Musiquen Johann Sebastian Bach waren Depressionen im heutigen Sinne wohl fremd. Zu konturlos zeigten sich Anfang des 18. Jahrhunderts noch die Umrisse eines eigenverantwortlichen Subjekts, das vernichtende Vorwürfe gegen sich selbst hätte erheben können, unter denen es erschöpft zusammenbricht. Affekte der Trauer und Melancholie hingegen dürften Bach sehr bekannt gewesen sein. Ihre klanglichen Spuren ziehen sich wie ein roter Faden durch seine Musik, in der sie mit anderen Affekten in vielfältige Beziehungen eintreten, um allgemeine, ein rein subjektives Verständnis übersteigende Empfindungen erfahrbar zu machen. Musikalische Bruchstücke werden hier allegorisch aneinandergereiht und ungewohnte Dissonanzen brechen immer wieder in die Akkorde und Melodiefragmente ein. Sie lassen eine zerklüftete musikalische Oberfläche entstehen, die durch die »Rhythmik eines beständigen Einhaltens, stoßweisen Umschlagens und neuen Erstarrens« gekennzeichnet sind, durch die Walter Benjamin das barocke Trauerspiel charakterisiert hat.
November 2020
Franz Kafka: Ein Hungerkünstler
Gelesen von Stephanie Schiller
»In den letzten Jahrzehnten ist das Interesse an Hungerkünstlern sehr zurückgegangen. Während es sich früher gut lohnte, große derartige Vorführungen in eigener Regie zu veranstalten, ist dies heute völlig unmöglich. Es waren andere Zeiten. Damals beschäftigte sich die ganze Stadt mit dem Hungerkünstler; von Hungertag zu Hungertag stieg die Teilnahme; jeder wollte den Hungerkünstler zumindest einmal täglich sehn; an den spätern Tagen gab es Abonnenten, welche tagelang vor dem kleinen Gitterkäfig saßen; auch in der Nacht fanden Besichtigungen statt, zur Erhöhung der Wirkung bei Fackelschein; an schönen Tagen wurde der Käfig ins Freie getragen, und nun waren es besonders die Kinder, denen der Hungerkünstler gezeigt wurde; während er für die Erwachsenen oft nur ein Spaß war, an dem sie der Mode halber teilnahmen, sahen die Kinder staunend, mit offenem Mund ...« (Franz Kafka)
Oktober 2020
Geteilte Einheit
Publikation beim Olms Verlag
»Die wahre [musikalische] Reproduktion«, so Theodor W. Adorno in einer kurzen Notiz aus dem Jahre 1946 »ist die Röntgenphotographie des Werkes. Ihre Aufgabe ist es, alle Relationen, Momente des Zusammenhangs, Kontrasts, der Konstruktion, die unter der Oberfläche des sinnlichen Klangs verborgen liegen, sichtbar [Hervorhebung B.S.] zu machen – und zwar vermöge der Artikulation eben der sinnlichen Erscheinung.« Die hier einleitend zitierte musikphilosophische Allegorie Adornos – musikalische Interpretation als Röntgenphotographie – bildet den Auftakt der Aufzeichnungen zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion, einer Sammlung von Textfragmenten, die ein letztendlich unvollendet gebliebenes Buchprojekt zum Thema der musikalischen Aufführung skizzieren sollten. Die deutlich-dunklen Klangfarben von Adornos Negativer Dialektik entfalten sich hier mit unnachahmlicher Kraft. Dennoch wirft seine ›Aufzeichnung‹ einige Fragen auf ...
Oktober 2020
Kinetik, Affekt, Interpretation
Seminar an der HfMT Hamburg, Wintersemester 2020/21
Aus welchen produktionsästhetischen Differenzen generiert sich eine gelungene musikalische Interpretation‹? Inwiefern werden in ihr motorisch-technische Bewegungsgefüge relevant, die eine gegebene Notation in hörbaren Klang umsetzen? Welche Resonanzen lassen sich zwischen der affektiven Kinetik der Tonproduktion und einer in den Werken festgeschriebenen Bewegung des musikalischen Affekts ausmachen? Aufbauend auf dem Seminar »Phänomenologie der musikalischen Bewegung« aus dem letzten Semester sollen diese Fragen vertiefend diskutiert werden. Dabei rückt insbesondere die musikalische Praxis in den Fokus der Aufmerksamkeit. Diese soll mit philosophisch-musiktheoretischen Analysekategorien in Beziehung gesetzt und anhand von »Live«-Interpretationen der Seminarteilnehmer*innen kritisch evaluiert werden ...
Oktober 2020
Ontologie der Dehnung
Vortrag beim 20. Jahreskongress der Gesellschaft für Musiktheorie
»Angenommen man zöge ein elastisches Band von A nach B – könnte man dessen Dehnung aufteilen?« Henri Bergson’s rhetorische Frage macht deutlich, dass eine Bewegung der Dehnung mit dem Raum, den sie durchläuft keine Verbindung eingeht. Sie entgeht vielmehr jeglicher Metrik. Während der Raum teilbar ist, (»sogar unendlich teilbar«), lässt sich eine Dehnung nicht teilen, ohne sich dabei in ihrer Beschaffenheit zu verändern. Sie erscheint als fragmentarische Ganzheit, die sich nur um den Preis ihrer singulären Zusammensetzung zergliedern lässt. Sie kann nicht mit Punkten in Raum oder Zeit, d.h. durch eine Sukzession unbeweglicher ›Schnitte‹ rekonstituiert werden. Einer solche Rekonstitution entginge das Wesen der Bewegung, sich aus intensiven Zwischenräumen zu generieren. Wie Gilles Deleuze in seiner Kino-Studie Das Bewegungs-Bild deutlich macht, mag man einerseits »noch so sehr zwei Punkte in Raum oder Zeit bis gegen unendlich annähern: die Bewegung wird sich immer in dem Intervall zwischen ihnen ergeben, also hinter unserem Rücken.« Andererseits kann man die Zeit so lange teilen wie man will: »die Bewegung wird stets in einer konkreten Dauer stattfinden, jede Bewegung wird also ihre eigene qualitative Dauer haben.«
August 2020
Resonanzen des Virtuellen
Dissertationsschrift, erschienen bei Turia + Kant
Die Studie Resonanzen des Virtuellen lässt Begriffe, die Gilles Deleuze in seinen Kino-Büchern Das Bewegungs-Bild und Das Zeit-Bild entwickelt hat in der Musikästhetik wirksam werden. Der Akzent liegt dabei auf Aspekten der musikalischen Bewegung, die als ästhetisches Medium rekonstruiert wird, in dem sich das Virtuelle klanglich artikulieren kann. Benjamin Sprick verfolgt die Vielheiten der musikalischen Bewegung in einem analytischen Dreischritt vom ›Solo‹ des Cellisten, der er selber ist, bis zum ›Tutti‹ des orchestralen Ensembles und der kammermusikalischen Partitur. Auf diese Weise wird ein künstlerisch-wissenschaftlicher Ansatz des musikalischen Denkens entworfen, der seine methodischen Fluchtlinien aus der instrumentaltechnischen Praxis generiert.
Juli 2020
Pachelbel auf der Müllkippe
Radiobeitrag, gemeinsam mit Stephanie Schiller
Korogocho heißt in Suaheli, der kenianischen Landessprache, »Chaos«, »Durcheinander«, »Abfall«. Der Slum liegt mitten auf einer Müllhalde. Geschätzt 300.000 Menschen leben hier, neben, auf und von Müll, den die 3,5-Millionen-Metropole Nairobi jeden Tag produziert – in Krankenhäusern, Restaurants, Fabriken und privaten Haushalten. 1996 wurde die Deponie offiziell geschlossen, um seither illegal weiter zu wachsen. Jeden Tag kommen rund 2000 Tonnen neuer Abfall an. Eine apokalyptisch anmutende Szenerie zeichnet sich ab, in der Menschen im Qualm schwelender Feuer den Müll nach Recyclebarem durchsuchen und im nahen Fluss Folien und Plastikflaschen waschen, begleitet vom Lärm der Dieselmotoren und vom Geschrei aasfressender Vögel ...
Juni 2020
Vorläufiges Résumé
Beitrag für die Gruppe Anti-Ödipus (GAÖ)
Guattari-Deleuze haben uns gewarnt: Die Maschine ist keine Metapher, insofern die Maschine wünschend ist und der Wunsch maschinisiert. Jetzt heißt es, mit diesem Anti-Ödipus-Effekt zu leben, der die Politik der Gefüge ins Sein einschreibt, um gleichzeitig eine a-disziplinäre Politik des Begriffs vorzuschreiben, die auf den neuesten Stand eines auf die Analyse des Kapitalismus gerichteten Maschinen-Denkens gebracht worden ist. Und es heißt, etwas damit zu machen und etwas Neues zu schaffen. Etwas, das sich weniger durch die intra-historischen Widerspüche des Kapitalismus bestimmen ließe als durch seine Fluchtlinien zwischen Geschichte und Werden. Weniger ein philosophisches Transponieren vom Majoritären zum Minoritären ist hier gemeint, als eine Problematisierung der Philosophie selbst – im Modus des Kleinen.
April 2020
Phänomenologie der musikalischen Bewegung
Seminar an der HfMT Hamburg, Sommersemester 2020
Wie kaum eine andere Kunstform ist Musik an Bewegungen gebunden. Sei es der Klang eines einzelnen Akkords, eine sich intensivierende Bogenbewegung oder die dynamische Gestaltung eines ausdrucksvollen Gesangs: Musik ist immer ›auf der Fahrt‹, motorisch-lebendig, sich selbst gegenüber verschoben. Ausgehend von einer Lektüre einschlägiger philosophisch-phänomenologischer Literatur (Husserl, Merleau-Ponty, Heidegger), sowie durch die Auseinandersetzung mit instrumentaltechnischen Fragen und Methodiken musiktheoretischer Analyse sollen im Seminar Grundzüge eines phänomenologischen Denkens der musikalischen Bewegung skizziert und praktisch evaluiert werden.
Februar 2020
Decoding the Virtual
Lecture at ArtSearch-Symposium
A cinematograph is initially – at least according to its etymological meaning – nothing more than a ›writer of motion‹. It records movements and stores them in a peculiar way in order to be able to reproduce and exhibit them simultaneously. In the case of the filmic cinematograph, visible movements are first recorded on celluloid as individual ›snapshots‹ and then reassembled into a continuous movement at the precise moment when they are exteriorly furnished with kinetic energy in the form of a rotary movement. A cello also shares features with a ›cinematographic apparatus‹. It converts kinetic energy into audible sound by setting in motion a multitude of resonating recording surfaces. Stimulated by the movement of the bow, the strings begin to vibrate. These vibrations inscribe themselves on the body of the instrument in order to interface with the air in the form of (more or less even) pressure fluctuations. They are »aerological«, they are air-bound, their cinematography is fleeting compared to that of celluloid. A sound wave moves through space as a movement. It is populated by micro-cinematographies which makes metaphysical distinctions between ›form‹ and ›matter‹ ultimately questionable. The ontological-cinematographic genesis of the musical material suggests that the virtuality of movement and its multiple relationships with time, as elaborated in Deleuze’s work on cinema, can also be demonstrated in the aesthetic operations of music ...
Januar 2020
Bach-Cellosuiten I, III & V
Solokonzert in Hamburg
Die 6 Suiten für Violoncello solo BWV 1007–1012 entstanden im Zuge von Johann Sebastian Bachs Tätigkeit als Kapellmeister und Director derer Cammer-Musiquen 1717–1723 am Hof von Köthen. Sie gehen aus ausführlichen experimentellen Recherchen hervor, die Bach zu dieser Zeit in Bezug auf die Instrumentalkammermusik durchführte und stellen den zweiten Teil eines Werkkomplexes dar, dessen ersten Teil die Sonaten und Partiten für Violine solo BWV 1001–1006 bilden. Heute sind Bachs Cellosuiten fester Bestandteil der Celloliteratur – sie bilden das unumgängliches Standartrepertoire für alle Cellist*innen, was nicht zuletzt durch eine in ihrer stilistischen Bandbreite beeindruckende Vielzahl von Gesamteinspielungen dokumentiert ist.
Januar 2020
Portrait und Farbe
Zur Aktualität Henri Bergsons
Die französische Differenzphilosophie verwirft die Vorstellung einer mit sich selbst identischen Gegenwart als Phantasma abendländischer ›Präsenzmetaphysik‹. Eine Hauptthese der Differenzphilosophie lautet: Es gibt keinen Begriff des Gegenwärtigen als ungeteiltem und mit sich selbst identischem Jetztpunkt. Vielmehr ist jede Gegenwart immer schon in sich selbst geteilt, unaufhebbar verschoben und somit ›ursprünglich verspätet‹. Wenn die ›reine Gegenwart‹ selbst jedoch das Undenkbare schlechthin ist, ändern sich auch die Bedingungen, unter denen von Vergangenheit und Zukunft gesprochen werden kann. Das berührt unter anderem die Rede von ›Gedächtnis und Erinnerung‹, um die es im Folgenden gehen soll. Die Ausgangsfrage lautet dabei, welche Beziehung zwischen einem Denken der Differenz, das sich die ›ursprüngliche Ursprungslosigkeit‹ zum Thema macht, und dem ›Gedächtnis‹ der Philosophiegeschichte besteht ...
2019
Dezember 2019
Cellounterricht in Kenia
Erfahrungsbericht aus Korogocho (Nairobi, Kenia)
Wer zum ersten Mal in den Slum Korogocho in Nairobi/Kenia fährt, fragt sich zunächst nicht, wie Musik hier möglich sein könnte, sondern wie sich an diesem Ort überhaupt überleben lässt. Korogocho befindet sich auf einer riesigen Mülldeponie und eröffnet das apokalyptische Szenario eines schwelenden Infernos, das das Leben von fast 200.000 Menschen in paradoxer Weise zugleich bedroht wie es ihnen als Lebensgrundlage dient. Die Familien leben hier größtenteils davon, große Mengen Müll zu sammeln, zu sortieren und weiterzuverwenden, eine Aktivität, die selbst die kleinsten Kinder aufnehmen. Korogocho ist kein Ort, an dem man eine differenzierte Musikkultur erwarten würde ...
Juli 2019
Potential vs. Möglichkeit
Vortrag an der HfMT Hamburg
»Jede Analyse ist unendlich, und es gibt nur Aktuelles im Unendlichen, in der Analyse.« Dieser kryptische Satz aus Gilles Deleuzes Buch Le Pli. Leibniz et le Baroque findet sich in einer Passage, in der es um die Konzeption des zureichenden Grundes und dessen Verhältnis zum Begriff des Virtuellen geht. In der deutschen Ausgabe des Buches ist dieser Satz falsch übersetzt. Dort heißt es: »Jede Analyse ist unendlich und es gibt nichts Aktuelles im Unendlichen, in der Analyse.« Die für Deleuzes Argumentation zentrale These ist hier unfreiwillig in ihr Gegenteil verkehrt. Der ›Fauxpas‹ macht deutlich, wie kompliziert die von Deleuze entwickelte Argumentation in Die Falte ist. In immer neuen Wendungen versucht Deleuze hier, die differenzphilosophischen Implikationen der Leibniz’schen Metaphysik zu entfalten, um sie mit den Grundmotiven seines eigenen Denkens in Verbindung zu bringen ...
Juni 2019
Musikalische Kinematographik
Zur Einschreibung und Reproduktion von Bewegung in der Musik
Ein Kinematograph ist – zumindest seiner etymologischen Wortbedeutung nach – zunächst nichts weiter, als ein ›Bewegungs-Schreiber‹. Er zeichnet Bewegungen auf, speichert sie in eigentümlicher Weise, um sie zugleich wieder- und weitergeben zu können. Im Falle des filmischen Kinematographen werden sichtbare Bewegungen zunächst in Form einzelner ›Momentaufnahmen‹ auf einem Filmband festgehalten, um sie in dem Augenblick zu einer kontinuierlichen Bewegung neu zusammenzusetzen und auf eine Leinwand zu projizieren, in dem ihnen von außen kinetische Energie in Form einer Drehbewegung zugeführt wird. Bewegungseinschreibung und Bewegungsreproduktion sind im Falle des filmischen Kinematographen zeitlich voneinander getrennt. Die ersten Kinematographen waren dementsprechend Filmkamera, Kopiergerät und Filmprojektor in einem. Auch ein Cello trägt gewisse Züge eines ›kinematographischen Apparates‹. Es wandelt kinetische Energie in hörbaren Klang um, indem es eine Vielzahl resonatorischer Aufzeichnungsflächen in Bewegung versetzt. Angeregt durch die Bewegung des Bogens beginnen die Saiten des Cellos damit, Vibrationen auszuprägen. Diese schreiben sich dem Cellokorpus ein, um sich der umliegenden Luft in Form von mehr oder weniger gleichmäßigen Druckschwankungen mitzuteilen ...
März 2019
Denker in steter Unruhe
Zum Tod von Hans-Joachim Lenger
Dass der Kapitalismus den Horizont seiner eigenen Zukunft längst hinter sich gelassen hat, wurde von Hans-Joachim Lenger niemals ernsthaft in Zweifel gezogen. In immer neuen sprachlichen Wendungen stellte er einer aus den Fugen geratenen politischen Gegenwart ihre niederschmetternde Diagnose und hob sich dabei deutlich von einer um sich greifenden und entschärfenden Kapitalismuskritik ab. Lenger legte ökonomische und semiotische Aporien im Aktuellen frei, deren Spuren bis weit in die Geschichte der Philosophie zurückreichen. Als vermeintlicher Vordenker einer in die Jahre gekommenen politischen Linken wollte er dabei allerdings nicht gelten. Kommt die politische Revolte doch insofern stets »zu früh«, als dass sie sich einer konzeptionellen Vorwegnahme konsequent entzieht.
Februar 2019
Hans-Joachim Lenger: Ein ganz großer Relotius
Aus: agoRadio 59: ›Implosionen der Narration‹
»Ende vergangenen Jahres platzte eine Informations- und Nachrichten-Blase, die sich in vielen Jahren hatte aufbauen und ein geneigtes Publikum mit sanfter Gewalt für sich hatte einnehmen können. Wie der Spiegel offenlegte, waren viele der hochgelobten journalistischen Emissionen, die sein Autor Claas Relotius mit seinem Namen gezeichnet und als Spiegel-Reportagen in Umlauf gesetzt hatte, Fälschungen gewesen. Und schien dies schon schwerwiegend genug, so brachte der Crash mehr noch den unwiderstehlichen Herdentrieb in Misskredit, der die Branche jahrelang in Bewegung versetzt und gesteuert hatte. Denn wer war dem sogenannten »Sturmgeschütz der Demokratie« nicht mit wehenden Fahnen gefolgt, wenn es den Boden der Republik pflügte, um zu ›sagen, was ist‹?«
Ferbruar 2019
Alles Käse?
Anmerkungen zur Quantenphysik
Wer am Morgen des 2. Januar dieses Jahres noch etwas schlaftrunken den Computer anschaltete, um auf diese Weise einen Wiedereinstieg in den bevorstehenden Berufsalltag wenigstens anzudeuten, wurde unfreiwillig mit den Grundproblemen der abendländischen Metaphysik konfrontiert: dem Big Bang und der Frage nach dem Großen Ganzen. »Forscher entdecken Überreste des Urknalls« war auf der Website des Nachrichtendienstes Spiegel-Online zu lesen: »Milliarden Jahre alte Gaswolke gesichtet, die Erkenntnisse darüber ermöglicht, wie sich die ersten Galaxien im Universum gebildet haben.« Diese Nachricht schlug ein, wie eine Bombe. Wo wenige Stunden zuvor noch bei Sekt und Chinaböllern die Sekunden heruntergezählt werden mussten, um den bevorstehenden Jahreswechsel mehr oder weniger bewusst zu registrieren, stellte die Eilmeldung von Spiegel-Online Einblicke in intergalaktische Dimensionen in Aussicht, die jedes irdische Maß überschreiten. »Die Gaswolke ist so weit entfernt«, so der Wortlaut des Artikels, »dass die Strahlung von ihr bis zu uns Milliarden Jahre unterwegs war. Die Astronomen sehen sie daher so, wie sie etwa 1,5 Milliarden Jahre nach dem Urknall war. Heute ist das Weltall 13,8 Milliarden Jahre alt.« Der Spiegel-Verlag, der nicht nur das Internet-Portal Spiegel-Online, sondern auch das gleichnamige Nachrichtenmagazin betreibt, war ganz offensichtlich mit dem Vorsatz ins Neue Jahr gestartet, 2019 weniger durch Skandalmeldungen um gefälschte Reportagen, als durch einen solide recherchierten Wissenschaftsjournalismus zu glänzen ...
Februar 2019
Verteidigung einer These
HFBK Hamburg Promotionskolloquium
Die kinematographische Verfassung des musikalischen Materials legt die Vermutung nahe, dass sich die von Gilles Deleuze in den Kino-Büchern herausgearbeitete Virtualität der Bewegung in den ästhetischen Operationen der Musik ebenso aufzeigen lässt, wie im Kino. Auch durch Musik können Kräfte der Bewegung eingefangen und zusammenmontiert werden, um ihnen in unterschiedlichen stilistischen Zusammenhängen ästhetische Konsistenz zu verleihen. Musikalische und filmische Bewegungseinschreibung folgen allerdings nicht nur sehr unterschiedlichen technischen Reproduktionsanordnungen, sondern auch voneinander abweichenden historischen Entwicklungslinien. Während die Geschichte des Films im technischen Sinn knapp eineinhalb Jahrhunderte umfasst, erstreckt sich die Geschichte der Musik übermehrere Jahrtausende, um sich im Dunkel ihrer eigenen Frühe zu verlieren ...
Januar 2019
Nationalismus und Rassismus
agoRadio-Gespräch mit Jan Weyand
»Wir sind in einer Situation außerordentlicher Unordnung, die die Staaten, die Nationen, das Selbstverständnis Europas betrifft. Wir haben es zu tun mit Wellen dessen, was man Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus, Ausländerhass usw. nennt. Pogromstimmungen macht sich breit, bis zum Abfackeln von Asylantenheimen. Mein Eindruck ist, was hier zum Ausdruck kommt, zum Ausbruch kommt, ist nicht eine unmittelbare Reaktion auf die derzeitige weltpolitische Situation der Flüchtlinge, sondern hat sich lange angestaut und bedient sich jetzt dieses Anlasses, um endlich Ausdruck zu werden. Würdest Du diese Einschätzung teilen?«
2018
Dezember 2018
Double Bind
Aus: agoRadio 56, ›Ausbrüche der Gewalt‹
Das deutsche Substantiv ›Volk‹ leitet sich unter anderem aus der althochdeutschen Sprachwurzel »voll« ab. Diese wiederum verweist – inmitten einer diffusen etymolo-gischen Verflechtung – auf das Verb »füllen«, was in etwa so viel wie »voll machen« oder »Füllung« bedeutet. Auch die »Fülle« ist hier nicht weit, die eine eben solche an weiteren Wortbedeutungen unter sich versammelt: »große Menge«, »Vielfalt«, Haufen«, »volles Maß«, »Anhäufung«, »Ansammlung« können hier laut Duden genannt werden, aber auch »die Masse«, welche sich wiederum aus dem lateinischen Substantiv massa ableitet, was »Klumpen« oder »Brotteig« bedeutet. Und so lässt sich ein leichtes Völlegefühl kaum vermeiden, wenn das Volk in Erscheinung tritt, die öffentlichen Plätze belagert und damit beginnt, seinem Begehren Ausdruck zu verleihen ...
November 2018
Möglichkeit und Wirklichkeit
Publikation, zusammen mit Jan Philipp Sprick
In seinem Denkbild von der tastenden Hand des Kindes zieht Adorno mehrere Motive seiner Musikästhetik zu einer negativ-dialektischen Allegorie des musikalischen Kompositionsaktes zusammen. Diese bewegen sich im Spannungsfeld von kompositorischer Arbeit, künstlerischer Innovation und der verwickelten Beziehung von ›Möglichkeit‹ und ›Wirklichkeit‹ des musikalischen Materials. Das musikalisch Neue und die ästhetische Utopie des Neuen sind dabei durch einen unüberbrückbaren Abstand getrennt. Was auch immer die tastende Hand des Kindes auf der Klaviatur an neuen Klängen hervorbringen mag, entspringt einer bereits bestehenden Ordnung systematisch geregelter Tonabstände, die den Möglichkeitsraum dessen eröffnet, was auf der Klaviatur in musikalischer Hinsicht verwirklicht werden kann. Die »Möglichkeiten der Kombination« sind durch die Wirklichkeit der technischen Anordnung »beschränkt«: »[E]igentlich«, so Adorno, »steckt alles schon in der Klaviatur. « Mögliches bleibt Wirklichem unterworfen. Das ›wirklich‹ Neue ist daher »eigentlich« unmöglich, so zumindest Adorno. Gleichzeitig taucht es immer wieder in und durch Musik auf, ohne dass sich genau sagen ließe, nach welchen Regeln es sich dabei Bahn gebrochen hat. ...
Oktober 2018
Die Intellektuellen und die Macht
Aus: agoRadio 56: ›Ausbrüche der Gewalt‹, gelesen von Nicola Torke
Michel Foucault: Ein Maoist sagte mir: »Ich verstehe, warum Sartre auf unserer Seite steht, warum er Politik macht und wie er sie macht. Auch dich verstehe ich einigermaßen: du hast dich eben immer mit dem Problem der Einsperrung beschäftigt. Aber Deleuze kann ich wirklich nicht verstehen.« Diese Frage hat mich sehr erstaunt, denn für mich gibt es da keine Unklarheit.
Gilles Deleuze: Vielleicht hat es damit zu tun, dass wir im Begriff sind, die Beziehung zwischen Theorie und Praxis neu zu fassen. Bis jetzt hat man entweder die Praxis als eine Anwendung der Theorie, als bloße Konsequenz verstanden; oder man hat gemeint, die Praxis müsse die Theorie inspirieren, sie könne neue Theorien schaffen. In dieser oder jener Richtung hat man ihre Beziehungen als Totalisierungsprozess aufgefasst. Für uns stellt sich die Frage wohl anders ...
September 2018
Anti-Bartleby
Publikation zur Paradoxie der Arbeitsverweigerung
»Nein. ›We would prefer not to.‹« Mit diesem Motto versucht ein unlängst in Berlin ins Leben gerufenes Zentrum für Karriereverweigerung den Zwängen der Arbeits- und Leistungsgesellschaft eine klare Absage zu erteilen. Das Netzwerk avantgardistischer Denker*innen hat von »Kapitalismus und Arbeitswahn« die Schnauze voll und möchte sich den falschen Versprechungen der »neoliberalen Epoche« durch einen »lebenslangen Generalstreik« entziehen. »Warum arbeiten wir? Für wen? Wofür? Was ist Arbeit und was nicht? Und müssen das alle machen – Arbeit?« Mit derartig komplexen Fragekatalogen konfrontieren die Karriereverweigerer*innen eine verblüffte Öffentlichkeit und ziehen für sich persönlich die Reißleine: Arbeit? Nein danke. Wir wollen lieber nicht ...
August 2018
Gilles Deleuze über Menschenrechte
Auszug aus einem Fernsehinterview von 1988
»Das ist keine Frage der Gerechtigkeit, das ist eine Frage der Jurisprudenz und der Rechtsprechung. All die Gräuel die der Mensch erleidet, sind konkrete Fälle. Es handelt sich nicht um Verstöße gegen irgendwelche abstrakten Rechte, es sind eben grauenhafte Fälle. […] Sich für die Freiheit einzusetzen, revolutionär zu werden, das bedeutet doch nichts anderes, als Rechtsprechung zu betreiben. Sich dagegen immer auf die Gerechtigkeit zu berufen... Gerechtigkeit – das gibt es nicht, Menschenrechte, das gibt es nicht! Was zählt ist die Rechtsprechung, die Erfindung des Rechts. Diejenige aber, die sich damit begnügen die Menschenrechte anzumahnen, die Menschenrechte herunterzubeten, das sind doch Vollidioten ...«
Juli 2018
Melodie vs. Harmonie
Vortrag an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Das Virtuelle wird von Deleuze in Die Falte immer wieder mit der offenen Totalität der Welt in Verbindung gebracht, die sich nur in ›Monaden‹ aktualisieren kann. Jede einzelne Monade reflektiert dieser an Leibniz anschließenden Lesart zufolge die unendlich gekrümmte Ereignis-Serie der Welt, wobei sie in ›klarer‹, d.h. bewusster Weise nur einen kleinen Teil von ihr ausdrücken kann, indem sie einen bestimmten Blickwinkel auf sie einnimmt. »Eben dieser klare Bereich einer Monade aber«, so Deleuze, »verlängert sich im klaren Anteil einer anderen, wie in derselben Monade sich der klare Anteil unendlich in die dunklen Zonen hinein verlängert, denn jede Monade drückt die ganze Welt aus.« Weil jede Monade die ganze Welt ausdrückt und durch diesen Ausdruck gleichzeitig das Ausgedrückte (also die Welt) permanent verändert, muss auch die Operation der Analyse der Welt als potentiell unendlich betrachtet werden. Sie trifft beim Versuch, einen Teil der Welt zu explizieren, immerzu auf weitere Faltungen des Denkens, deren Implikationen sie zwar enthüllen kann, allerdings nur, um auf diese Weise die unendliche Aktualisierung der Welt fortzusetzen. Die Analyse ist für Deleuze daher mit einer Bewegung des Denkens gleichzusetzen, die ins Unendliche hineinragt bzw. aus diesem hervorgeht. Sie denkt Gedachtes weiter und knüpft gleichzeitig an es an, ohne dass dabei ein Anfang oder ein Ende abzusehen wäre.
Februar 2018
Adam und Crain
Aus: agoRadio 48, ›Narziss auf den Straßen‹
Optimum ist das lateinische Neutrum von Optimus, was in etwa so viel wie ›Der Beste‹ bzw. ›Hervorragenste‹ bedeutet und den Superlativ des Adjektivs bonus bildet, was wiederum mit ›gut‹ oder ›tüchtig‹, aber auch ›schön‹ oder ›tugendhaft‹ übersetzt werden kann. Durch und durch erstrebenswerte Eigenschaften also, deren weniger erfreuliche Gegenspieler sich im lateinischen Wort malus versammeln. Malus heißt ›schlecht‹, ›böse‹, ›fehlerhaft‹, ›unzuverlässig‹ aber auch ›untüchtig‹, ›unbrauchbar‹ und ›verderbend‹. Es lässt sich in den Superlativ Pessimus steigern, was so viel wie ›Der Schlechteste‹ bedeutet, jemand, der nur noch durch sein eigenes Neutrum überboten wird: Pessimum, das Überflüssige par excellence, die gesteigertste Form dessen, was sich in Sachen Nutzlosigkeit erreichen lässt.
Januar 2018
Krautrock
Ein Gespräch mit Christoph Dallach
»In ihrer Hilflosigkeit haben englische Journalisten gesagt: ›Oh, the fucking Krauts, but it's great music, let's call it »Krautrock«‹. Das hat mit Rock nichts zu tun, das ist überwiegend eine elektronische Musik und eine sehr avatgardistische Musik. Also die Scorpions zum Beispiel, sind kein Krautrock ... Das war die erste Generation nach dem Krieg, die mit dem Krieg nichts zu tun hatte, das war sozusagen der ›Soundtrack der 68er ... Das war eine Generation, die sich wahnsinnig mit ihren Lehrern gestritten hat. Die ganzen Dritt-Reich-Lehrer sind einfach nahtlos in ihren Job in der BRD übergewechselt. Die hatten alle Nazi-Lehrer, die die dann oft gesagt haben: ›Das sind alles Verräter, wir haben nur verloren, weil wir verraten worden sind. Das haben die sich alle anhören müssen, zumindest sehr viele von denen.‹«
2017
Dezember 2017
Das Rhizom
Ein Essay zur philosophischen Botanik
Der Begriff ›Rhizom‹ (von altgriechisch ῥίζωµα, rhizoma ›Eingewurzeltes‹) stammt ursprünglich aus der Botanik, wo er als Bezeichnung für bestimmte Wurzelgeflechte dient, die meist unterirdisch oder dicht über dem Boden wachsen und über ein sogenanntes ›Sprossenachsensystem‹ verfügen. Beispiele sind der allseits beliebte Ingwer, der Chinaschilf oder auch der Nieswurz. Ein Rhizom kann die unterschiedlichsten Ausprägungen annehmen, von der verästelten Ausbreitung in alle Richtungen der Oberfläche bis hin zur Verdichtung in einer Zwiebel oder Knolle. Dabei wächst das Rhizom nicht, wie zum Beispiel ein Baum, in eine bestimmte Richtung, sondern es verteilt sich dezentral: Es kann an jeder beliebigen Stelle gebrochen und zerstört werden und wuchert entlang seiner eigenen oder anderer Linien weiter.
November 2017
Glissando II
Audio-track for Cello and digital distortion
The three-minute track mixes analogue and digital Cello sounds with different kinds of electroacoustic devices focussing on the instrumental technique of glissando and (a loss of) sonic control. As an ›image-sonore‹ Glissando II requires not to be an artwork but an acoustic ›study‹ on the musical metaphors Gilles Deleuze uses in his »Postscript on the Societies of Control« (›continuus variation‹, ›modulation‹, ›universal deformation‹) respectively on the question, how the digital Meta-Code could be de-coded musically.
Oktober 2017
Universeller Verzerrer
Rezension von Andrej Koroliovs Oper ›Hinterhalt Boris‹
»In den Disziplinargesellschaften«, so Gilles Deleuze in seinem 1990 erschienenen Text Postskriptum über die Kontrollgesellschaften, »hörte man nie auf anzufangen (von der Schule in die Kaserne, von der Kaserne in die Fabrik), während man in den Kontrollgesellschaften nie mit irgendetwas fertig wird: Unternehmen, Weiterbildung, Dienstleistung sind metastabile und koexistierende Zustände ein und derselben Modulation, die einem universellen Verzerrer gleicht. Franz Kafka, der schon an der Nahtstelle der beiden Gesellschaftstypen stand, hat im ›Prozeß‹ die fürchterlichsten juristischen Formen beschrieben: Der scheinbare Freispruch der Disziplinargesellschaften (zwischen zwei Einsperrungen) und der unbegrenzte Aufschub der Kontrollgesellschaften (in kontinuierlicher Variation) sind zwei sehr unterschiedliche juristische Lebensformen.«
September 2017
Doublebind und Schizostrom
Vortrag beim Big Data Weekend
Wovon aber spricht die Logik dieser Teilungen und Verteilungen? Davon, dass jedes Medium bereits auf Abstand zu sich selbst gegangen ist und davon, dass es sich geradezu dadurch definiert, anderen Medien und ihren Decodierungen geöffnet zu sein. Was immer codiert wird, ist es qua Öffnung, und stets ist der Code deshalb ein anderer, als er ist, stets hintergeht er sich selbst. Im Spiel von Decodierung und Recodierung wiederholt sich, was dem Code als Asignifikanz des Ereignisses eingelassen ist, das sich medial iteriert. Aus dieser Iteration generieren sich unablässig andere Latenzen, eröffnen sich andere Möglichkeiten einer Verschaltung. Und dies kommt einer beständigen Nomadik gleich, die unabschließbar bleibt ...
August 2017
Hannah Arendt: Das Urteilen
Aus: agoRadio 37: ›Urteilskraft‹, gelesen von Nicola Torke
»Wenn ich damit recht habe, dass es bei Kant eine Politische Philosophie gibt, dass er sie jedoch, im Gegensatz zu anderen Philosophen, niemals geschrieben hat, dann scheint es naheliegend, dass wir in der Lage sein sollten, sie, wenn überhaupt, in seinem Gesamtwerk zu finden und nicht nur in den wenigen Aufsätzen, die üblicherweise unter diesem Titel zusammengestellt werden. […] Lassen Sie uns mit etwas beginnen, was heutzutage kaum jemanden überrascht, was jedoch noch immer der Betrachtung wert ist. Vor und nach Kant hat keiner, ausgenommen Sartre, ein berühmtes philosophisches Werk geschrieben, das er mit dem Titel ›Kritik‹ versah. Wir wissen zuwenig oder auch zuviel darüber, warum Kant diesen ungewöhnlichen und irgendwie überheblichen Titel, der so klingt, als wenn er nichts anderes gewollt hätte, als alle seine Vorgänger zu kritisieren, gewählt hat.« (Hannah Arendt)
August 2017
Beethoven in der Schanze
Aus: agoRadio 42, ›Kritik der Gewalt‹
Während die durch die Strapazen des Verhandlungsmarathons sichtlich geschwächten Staatsoberhäupter nämlich dabei gefilmt wurden, wie sie sich während der ein oder anderen Passage des 1. Satzes auf der Haupttribüne der Elbphilharmonie ein kleines Nickerchen gönnten, nutzte der schwarze Block das muntere Scherzo dazu, sich vom Millerntorplatz zum Neuen Pferdemarkt zu deterritorialisieren, um punktgenau zum großen Finale mit einsetzendem Chor und Gesangssolisten den Barrikadenkampf am Schulterblatt zu eröffnen. Die Exposition des melodischen Gassenhauers »Freude schöner Götterfunken«, der der Europäschen Union seit 1995 als Hymne dient, wurde daher durch einen heftigen Wasserwerfereinsatz der Hamburger Polizei beantwortet, was den folgenden Apell des Bassbaritons »Oh Freunde, nicht diese Töne!« wie eine Farce erscheinen ließ.
Februar 2017
Untätige Produktivität
Rezension einer CD Víkingur Ólafssons
Es gibt momentan Tage, an denen möchte man sich am liebsten zu Hause einschließen und die Bettdecke über den Kopf ziehen. Zu ernüchternd wirken die nicht enden wollenden Hiobsbotschaften aus einer vermeintlich ›postfaktisch‹ degenerierten politischen Wirklichkeit, als dass sich ihnen noch tragfähige Affekte des Widerstands oder das Vorhaben einer konsistentenGesellschaftskritik entgegensetzen ließen. Vielmehr macht sich ein dumpfes Gefühl der Ohnmacht breit, das mit der Ahnung einhergeht, längst selbst Teil einer Realität geworden zu sein, die sich im Surrealen zu verlieren droht. An solchen Tagen, an denen es sich eigentlich empfiehlt, den Schlafanzug anzubehalten und prophylaktisch die Fenster zu verrammeln, kommen die kristallklaren Klänge, die der isländische Pianist Víkingur Ólafsson auf seiner neuen CD Philipp Glass × Piano Works dem Klavier entlockt, wie gerufen. Sie lassen etwas Licht ins trostlose Dunkel der Melancholie fallen und helfen, in die lähmende Resignation ein paaröffnende Resonanzräume zu schlagen. Ólafsson’s bei der Deutschen Grammophon erschienene CD ist den Klavieretüden des US-amerikanischen Komponisten Philip Glass gewidmet, der am 31. Januar dieses Jahres seinen 80. Geburtstag gefeiert hat ...
Januar 2017
Der Bocksprung
Alain Badiou's Versuch die Jugend zu verderben
Alain Badiou versucht der Jugend gegenüber ganz offensichtlich eine symbolische Vaterfunktion einzunehmen, die er ihren realen Eltern nicht mehr zuzutrauen scheint. Wie er mehrfach betont, sieht sich die Gesellschaft aktuell mit nichts weniger als einer »historische[n] Krise der symbolischen Ordnung« konfrontiert. Deren Hauptsymptom kann in einem indifferenten Kontinuum zwischen Jugend und Erwachsensein ausgemacht werden, das nicht mehr – so wie früher – durch Sicherheit stiftende Vorgänge der Initiation strukturiert ist. Die Eltern, die ihren Sprösslingen eigentlich sagen müssten, wo es im Leben lang geht, bleiben Badiou zufolge selber Kinder und geben dadurch ein denkbar schlechtes Vorbild auf dem Weg zum Erwachsenwerden ab. »Ohne Initiation«, so Badiou, »verharren die Jugendlichen in einer Art unendlicher Adoleszenz«, deren paradoxer Imperativ »Jung soll man sein, jung soll man bleiben« eine »Infantilisierung des Erwachsenenseins« zur Folge hat ...
2016
November 2016
Das souveräne Ohr
Aus: agoRadio 33, ›Souveränität der Kunst‹
»Von einem anderen Standpunkt aus« so Gilles Deleuze in einer 1984 erschienenen Studie über den irischen Maler Francis Bacon, »verliert die Frage nach der Scheidung der Künste, ihrer jeweiligen Autonomie, ihrer möglichen Hierarchie jegliche Bedeutung. Denn es gibt eine Gemeinschaft der Künste, ein gemeinsames Problem. In […] der Malerei wie in der Musik geht es nicht um Reproduktion oder Erfindung von Formen, sondern um das Einfangen von Kräften. […] Die Aufgabe der Malerei ist als Versuch definiert, Kräfte sichtbar zu machen, die nicht sichtbar sind. Ebenso bemüht sich die Musik darum, Kräfte hörbar zu machen, die nicht hörbar sind. Das ist eine Selbstverständlichkeit.«
November 2016
Nicola Torke: Fluchtlinien der Grausamkeit
Aus: agoRadio 33, ›Die Souveränität der Kunst‹
Santiago Sierra wird als radikal provozierender Künstler gehandelt. Wie Nicola Torke in ihrem Beitrag anhand verschiedener Beispielen verdeutlicht, gilt seine Leidenschaft den Mechanismen und Folgen des globalen Kapitalismus, dessen grausame Werkzeuge er mit seinen Konzepten zu enttarnen und auszubreiten sucht. Seine Werkkonzeptionen rekurrieren nicht nur auf Prinzipien der Industrieproduktion, sondern auf logistische Abläufe des Güterverkehrs, auf die repressive Organisation abhängiger Beschäftigungsverhältnisse, auf soziale Normierung und Ausgrenzung mittels legislativer, judikativer und exekutiver Gewalt, auf die Integration amoralischer Interessen durch deren wirtschaftliche, politische und technologische Standardisierung und Legitimation. Dabei versteht Sierra sich durchaus als Teil des Systems, als Produzent von Luxusgütern, als Agent Provocateur, als Heizer einer Debatte um moralische und ethische Grenzen des Kunstmachens ...
November 2016
In der Höhle
Anmerkungen zum Okularzentrismus
Während die Phantasie eng mit der Imagination oder der inneren Einbildungskraft des Menschen verbunden ist, die spätestens seit der Romantik zum Hauptschauplatz ästhetischer Erfahrung und Produktion erklärt wird, geht es in der Phantastik um eine wirkungsvolle Überschreitung von Realitätsgrenzen, wie sie sich zum Beispiel im Fernsehen anhand verschiedener Fantasy-Serien nachvollziehen lässt, die so vielsagende Titel wie Game of Thrones, Akte X oder The Walking Dead (›Die wandelnden Toten‹) tragen. Nicht nur die zuletzt genannte Fantasy-Serie, die von blutsaugenden Zombies und einer Rückkehr der Untoten berichtet, macht deutlich, dass durch das griechische Verb phantázesthai, was in etwa so viel wie ›erscheinen‹ bzw. ›sichtbar werden‹ bedeutet, immer auch etwas Unheimliches und Unkontrollierbares adressiert werden soll, das Unterscheidungen von ›wahr‹ und ›falsch‹, ›wirklich‹ und ›unwirklich‹ bzw. ›real‹ und ›eingebildet‹ porös werden lässt. Denn wenn von phantastischen Phantasien die Rede ist, ist auch das Phantasma nicht weit, also eine Wahnvorstellung oder Halluzination und auch nicht das Phantom, ein Trugbild beziehungsweise Gespenst, das durch seine etymologische Nachbarschaft zur Phantasie jeden Versuch einer klaren Definition dessen, was es mit dieser auf sich haben könnte von Anfang an ins Wanken geraten lässt. Und so hat die abendländische Philosophie seit ihren Anfängen versucht, die Macht der Phantasie einzuschränken und ihrer Herr zu werden, um sie als Produzentin von ›Trugbildern‹ und ›Simulacren‹ vom heiligen Bezirk der wahren Ideen auszuschließen ...
Oktober 2016
Aporien der Musik
Klang als Sinnzusammenbruch (agoRadio 32)
Die Musik hat sich im 20. und 21. Jahrhundert in einer Weise diversifiziert, die den Versuch einer einheitlichen Definition dessen, was sie ist, was sie war bzw. was sie sein soll als aussichtsloses Unterfangen erscheinen lässt. Jedes musikalische Geschmacksurteil, jede Abgrenzung von musikalischen Genres und Stilen, jeder Versuch, das musikalische Material zu einer stimmigen‹ Gesamtkomposition zusammenzufügen, begibt sich daher auf Abwege und in Sackgassen, weil er einem Gegen-stand habhaft zu werden versucht, der sich einem dauerhaften Zugriff kontinuierlich entzieht. Die Sendung versucht, diesen Aporien der Musik nachzugehen. Ihre Beiträge nähern sich von verschiedenen Richtungen aus den Grenzen an, die dem Denken durch die Musik gezogen werden ...
September 2016
Begegnung mit der Klangfarbe
Vortrag an der HMTMH Hannover
Die Klangfarbe lässt sich nicht als ›Zusatz‹ bzw. nachträgliche ›Einfärbung‹ eines bereits bestehenden Klanggeschehens begreifen. Sie taucht vielmehr immer gemeinsam mit dem Klang auf, um ihn gleichzeitig in Richtung einer anderen Ordnung des Sinnlichen hin zu überschreiten. Die Klangfarbe übersteigt den Klang, um gleichzeitig in ihm aufzugehen. Genau darin besteht ihre paradoxe ontologische Verfassung, die ihr den von Deleuze erwähnten Charakter eines ›problematischen sinnlichen Zeichens‹ verleiht, das zwar zum Denken nötigt in letzter Konsequenz aber nicht gedacht werden kann. Dieser problematische Charakter der Klang-Farbe kündigt sich bereits in ihrem Begriff an, der eine intensive Spannung zwischen zwei Registern des Sinnlichen impliziert. Denn wie lässt sich das Verhältnis von Klang und Farbe bestimmen?
August 2016
Allegorien der Trauer
Allemande aus der Suite für Violoncello solo BWV 1011
Die Entstehung der Suite für Violoncello solo c-moll BWV 1011 fällt in eine Zeit, in der ein tragisches Ereignis Bachs Leben aus den Fugen geraten ließ: der unerwartete Tod seiner ersten Frau Maria Barbara im Jahr 1720, mit der er fünf gemeinsame Kinder im Alter von vier bis elf Jahren hatte. Der Bericht des Nekrologs fällt der damaligen Zeit entsprechend nüchtern aus, Zitat: »Nachdem er mit dieser seiner ersten Ehegattin 13 Jahre eine vergnügte Ehe geführet hatte, wiederfuhr ihm […] der empfindliche Schmerz, dieselbe bey seiner Rückkunft von einer Reise, […] todt und begraben zu findenohngeachtet er sie bey der Abreise gesund und frisch verlassen hatte. Die erste Nachricht, dass Sie krank gewesen und gestorben wäre, erhielt er beym Eintritte in sein Hauß.«
Juni 2016
Manola Antonioli: Virtuelle Wege
Vortrag an der HFBK Hamburg, gelesen von Nicola Torke
»Mein Ausgangspunkt wird die Lektüre eines Textes von Gilles Deleuze mit dem Titel ›Was die Kinder sagen‹ sein, der 1993 als 9. Kapitel des Bandes Kritik und Klinik veröffentlicht wurde. Beeinflusst von der psychischen Kartographie des Sonderpädagogen Ferdinand Deligny, der in den Cevennen autistische Kinder betreute, deren Laufwege und scheinbares Umherschweifen er dank der berühmten lignes d’erre beschrieben hat, erwähnt Deleuze in diesem Text die Psychologie des Kindes: ›Unablässig sagt das Kind, was es tut oder tun will: die Milieus auf dynamischen Wegen erforschen und deren Karte erstellen. Die Wegekarten sind wesentlich für die psychische Aktivität.‹ Der kleine Hans, dessen Fall Freud in der Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben untersucht hat, fordert beispielsweise, die Wohnung der Familie verlassen zu dürfen, um die Nacht bei der Nachbarin zu verbringen ...«
Juni 2016
Der Griff in die Hose
Hygiene am Spielfeldrand
»Ganz ehrlich, ja ... Die Bilder hab’ ich dann auch gesehen am nächsten Tag und natürlich macht man manche Dinge im Unterbewusstsein, das war mir irgendwie nicht bewusst, dass man so... Aber... Es ist passiert und, natürlich tut’s mir leid aber ... Man ist auch voller Adrenalin und voller Konzentration und – die Dinge die dann passieren manchmal, die kann man irgendwie gar nicht bewusst wahrnehmen, also von daher, versuche ich mich in irgendeiner Form anders zu verhalten, klar.« (Joachim Löw)
Mai 2016
Alles gut
Aus: agoRadio 27, ›Anmerkungen zum Faschismus‹
Na? Alles gut bei Dir?« – »Ja ja, alles gut. Und bei Dir? Auch alles gut?« – »Och, naja ... Alles gut.« Derart sinnlose Frage-und-Antwort-Spiele machen deutlich, dass es bei der lässig-coolen Floskel vor allem darum geht, Ruhe und Gelassenheit auszustrahlen. Angesichts vermeintlich bedeutungsloser Vorkommnisse eines noch bedeutungsloseren Alltags lässt man sich nicht unnötig aus dem Konzept bringen. Man findet im Großen und Ganzen und überhaupt ›Alles‹ ein-fach nur ›gut.‹ Die Einigkeit suggerierende Parole wirkt dabei wie eine sprachliche Abdichtung gegen möglichen Streit oder überflüssige Missverständnisse. Sie lässt Frage und Antwort zusammenfallen und eröffnet auf diese Weise einen sprachlichen Zirkel, in dem die unausgesprochene Übereinkunft, sich gegenseitig in Ruhe zu lassen, ihre immer gleichen Bahnen ziehen kann.
April 2016
Jean-Luc Nancy: La partition des sexes
Workshop in Montevago, Sizilien
»Ich habe nicht die Absicht, vom Sex als einer anwesenden und zugänglichen, gut zu greifenden, jederzeit erforschbaren und erforschten ›Realität‹ zu sprechen. Gleichzeitig spreche ich natürlich von einer ›Sache‹, die immer da ist und die uns vielleicht mehr durchquert als wir denken. Die Sexualität, der sexuelle ›Akt‹ oder der sexuelle ›Verkehr‹ (je nachdem, wie man es ausdrücken will) sind vielleicht viel weniger präsent und viel flüchtiger, als wir es unsspontan vergegenwärtigen. Ich verstehe den Sex daher als etwas anderes als die Sexualität. Ich werde nicht von einer Funktion sprechen, weder von einer physiologischen noch einer psychologischen und auch nicht einer sozio-psychologischen. (Pause) Obwohl all das natürlich am Horizont der Überlegungen präsent sein wird, die ganze ›Physio-Psycho-Sozio-Logie‹ des Sexes. Sie webt den ›Stoff‹ der Erfahrung, über die wir sprechen, wenn wir über den Sex sprechen.« (Jean-Luc Nancy)
April 2016
The restlessness of the virtual
Lecture at HfMT Hamburg
Much like the different strings on an instrument can enter into relations of resonance, there are different ›planes‹ of thought that respond to their own constitutive forces, but that can set one another in vibration in manifold ways. The ›planes‹ of art, science and philosophy are thought by Deleuze and Guattari to be de jure (wich means trough the transcendental use of their faculties) radically distinct from each other. Art is not science and philosophy not art. Nevertheless, the authors suggest that they can de facto produce different types of ›interferences‹ by exceeding themselves towards the other plane. Such an ›interference‹ appears for instance when, quote What is Philosophy? »a scientist tries to create functions of sensations [...] like [...] in theories of colour or sound [...] or when an artist creates pure sensations of concepts or functions as we see in the varieties of abstract art […].« Following Deleuze and Guattari‘s interpretation, the virtual potential of science can therefore exceed itself towards art when actualised in forms of artistic thought. But any such actualisation must in turn modify it in regards to the virtual potential that grounds it. This, again, can express itself in form of interferences with philosophy and so on and so forth. It is these kinds of interferences that draw artistic and scientific research into permanent restlessness. What resonates here is the fundamental difference between art and science, and their chaotic timbres that can never be fully represented or conceptually grasped.
April 2016
Isolda Mac Liam: Rapports de Pouvoir
Aus: agoRadio 26, ›Die Eklats des Genießens‹
»Was ist Sex? Gemeinhin stellt sich die Frage nicht, denn definiert als eine bestimmte physische Handlung, zu der sich ein, zwei oder mehr Teilnehmer aufmachen, scheint die Sache weitestgehend begriffen. Man kann Sex kaufen, lernen, optimieren. Mit dem Schwinden der ihm auferlegten Tabus, grassiert ein Optimismus des ‚Sex‘, der mit Heilsversprechen und Selbstgesuchen versehen wird. Findet er vielleicht nicht auf der profansten Ebene des Alltagslebens statt, scheint er zumindest bekannt, wenn nicht sogar nützlich. So wird auch in Nancys Essay Es gibt – Geschlechtsverkehr eine Handlung zu Wort gebracht, die banal, alltäglich und durchaus durchführbar erscheint. Doch schon der Titel weist in seiner Paraphrase Lacans auf das unsichere Gebiet hin, auf das sich diese Auseinandersetzung begibt, handelt es sich doch um die ironische Verdrehung der berühmten Aussage, nach der es eben keinen Geschlechtsverkehr gäbe ...« (Isolda Mac Liam)
Manuskript lesen Weitere Informationen
2015
Oktober 2015
Polyphonie des Virtuellen
Vortrag an der UdK Berlin
»Die wahre [musikalische] Reproduktion«, so Theodor W. Adorno in einer kurzen Notiz aus dem Jahre 1946 »ist die Röntgenphotographie des Werkes. Ihre Aufgabe ist es, alle Relationen, Momente des Zusammenhangs, Kontrasts, der Konstruktion, die unter der Oberfläche des sinnlichen Klangs verborgen liegen, sichtbar [Hervorhebung B.S.] zu machen – und zwar vermöge der Artikulation eben der sinnlichen Erscheinung.« Die hier einleitend zitierte musikphilosophische Allegorie Adornos – musikalische Interpretation als Röntgenphotographie – bildet den Auftakt der Aufzeichnungen zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion, einer Sammlung von Textfragmenten, die ein letztendlich unvollendet gebliebenes Buchprojekt zum Thema der musikalischen Aufführung skizzieren sollten. Die deutlich-dunklen Klangfarben von Adornos Negativer Dialektik entfalten sich hier mit unnachahmlicher Kraft. Dennoch wirft seine ›Aufzeichnung‹ einige Fragen auf ...
Juni 2015
Die Klaviatur des Seins
Vortrag im Golem Hamburg
Gould murmelt und summt nicht in einem ›sinnhaften‹ Sinn. Seine Stimme wird vielmehr zum Resonanzboden eines von außen, aus Richtung der Musik auf ihn einwirkenden Klang-Sinns. Sens heißt im Französischen nicht nur ›Sinn‹, sondern auch ›Richtung‹. Seine summende Stimme erscheint als Echo eines musikalischen Subjekts, das er ›nie gewesen sein wird‹, weil es – nur aus Verweisen bestehend – unendlich in sich selbst widerhallt. Ein Subjekt also, das sich nur hören, niemals aber ›vernehmen‹ und in seiner Selbstpräsenz erkennenkann. Nancy sagt: »Es gibt ›Subjekt‹ (was stets bedeutet: ›Subjekt eines Sinnes‹) nur widerklingend, auf ein Hinausschwingen antwortend, auf einen Ruf, auf eine Zusammenrufung von Sinn.« Gould gerät somit am Klavier sich selbst lauschend in das Register einer verschobenen Selbstpräsenz.
April 2015
Peggy Parnass liest Rose Ausländer
Aus: agoRadio 15, ›Am Saum des Sinns‹
Wasser mein Kleid
mein Schuh
gescheitertes Schiff
Regenbogen mein Hut
Wer wird mich erkennen?
Ungesagt
Ungesagt alles
die ersten Eröffnungen
noch nicht Fuß gefasst
im Gehör ...
(Rose Ausländer)
April 2015
Thomas Bernhard, Der Untergeher
Gelesen von Markus Boysen
»Ich kann heute gar nicht mehr sagen, wie ich auf die Musik gekommen bin. Alle in meiner Familie waren sie unmusikalisch, antikünstlerisch, hatten zeitlebens nichts mehr gehasst als Kunst und Geist, das aber wahrscheinlich war das Ausschlaggebende für mich, mich eines Tages in das zuerst nur gehasste Klavier zu verlieben und einen alten Familien-Ehrbar gegen einen tatsächlich wunderbaren Steinway einzutauschen, um es der gehassten Familie zu zeigen, den Weg zu gehen, von welchem sie von Anfang an erschüttert gewesen war. Nicht die Kunst, nicht die Musik, nicht das Klavierspiel ist es gewesen, nur die Opposition gegen die Meinigen, dachte ich. Das Klavierspiel auf dem Ehrbar hatte ich gehaßt, es war mir von den Eltern aufgezwungen gewesen wie allen andern in der Familie, der Ehrbar war ihr Kunstmittelpunkt gewesen und sie hatten es darauf bis zu den letzten Brahms- und Regerstücken gebracht. Diesen Familienkunstmittelpunkt hatte ich gehasst, aber den mir von meinem Vater erzwungenen, unter den fürchterlichsten Umständen aus Paris herbeigeschafften Steinway geliebt. Ich musste auf das Mozarteum gehen, um es ihnen zu zeigen. Ich hatte ja überhaupt keinen Musikbegriff und das Klavierspiel war mir niemals eine Leidenschaft. Aber ich benützte es als Mittel zum Zweck gegen meine Eltern und die ganze Familie ...« (Thomas Bernhard, Der Untergeher)
Mai 2015
Musik und Macht
Seminar an der HFBK Hamburg, zusammen mit David Wallraf
Die Musik und die Macht – eine Allianz, die erst noch entziffert werden will. Während zeitgenössische Machttheorien in vielen ästhetischen Feldern bereits seit Jahren eingehend diskutiert werden, ist die Musik von einer machttheoretischen Reflexion bisher weitgehend verschont geblieben. Dabei ist sie in dieser Hinsicht kein unbeschriebenes Blatt. Wie alle ästhetischen Dispositive geht auch Musik aus einer machtförmigen Disziplinierung hervor, die sich nur nachträglich entziffern lässt – und durch diese Entzifferungsarbeit selbst permanent erneuert. Daher ist bereits die Rede von ›der Musik‹ problematisch. Sie unterwirft eine Vielzahl ästhetischer Praktiken und kultureller Techniken einer begrifflichen Eingrenzung, die niemals die differentiellen Formen menschlicher Schallorganisation ganz erfassen kann.
April 2015
Virtuelle Kiste mit Musik
HFBK Hamburg, Jahresausstellung
Meine Bedenken gegenüber der Metapher der ›Kiste‹ auf der einen Seite und den Zwang sie für die Ausstellung verwenden zu müssen auf der anderen, versetzte ich insofern in eine Resonanz, als ich die Kiste zu einem Musikinstrument umfunktionierte, das sich beim Musizieren selbst zerstört. Ich pulverisierte den Karton mit einer Parmesan-Reibe und nahm die rhythmischen Geräusche – dabei die Sarabande über Kopfhörer hörend – auf. Das Ergebnis waren 25 Ton-Spuren ›Geraspel‹, mit denen sich die Tonaufnahme ergänzen und in musikalischer Hinsicht einstäuben ließ ...
Februar 2015
Lieber keine Ausnahme
Aus: agoRadio 13: ›Ausnahmezustände‹, zusammen mit Mareike Teigeler
Einen Punkt des Quadrates meiden die Personen allerdings. Es ist ein kleines schwarzes Loch in seiner Mitte. Genau in dieser Mitte, wo die Scheitelpunkte des Quadrates sich kreuzen, bestünde die Möglichkeit, das Potential eines Zusammentreffens. Nur im Mittelpunkt des Quadrats könnten sich ihre Laufwege treffen. Die Personen stürzen zwar immer wieder auf diese Mitte zu, schlagen dann aber abrupt einen Haken, um dem Mittelpunkt des Quadrates und somit auch einander auszuweichen. »Die Körper meiden einander, aber den Mittelpunkt meiden sie absolut.« Diese Choreographie entzieht dem Raum seine Potentialität. Sie macht jedes Zusammentreffen der vier Personen unmöglich. Die Möglichkeit des Zusammentreffens wird erschöpft, weil die Figuren sich erschöpfen: immer weiterlaufen, funktionieren, ohne nachzudenken.
Januar 2015
»Das klinget so herrlich ...« Zur Feier der Untätigkeit
Vortrag an der HFBK Hamburg
Giorgio Agambens Buch über Herrschaft und Herrlichkeit klingt aus in Meditationen über die Untätigkeit, über das sabbatische Wesen des Menschen, wie er sagt. Denn Untätigkeit, Muße, Enthaltsamkeit von aller Geschäftigkeit, das In-Sich-Selbst-Ruhen jenseits aller oikonomía, aller Arbeit ist Kennzeichen der Herrlichkeit Gottes, seiner Immanenz und seiner Vollkommenheit. Und dies ist, wie Agamben gezeigt hat, eine der grundlegenden Dispositionen, die unser Weltverständnis bis in die Moderne hinein geprägt und dimensioniert hat. Auch dort, wo sich die okzidentale Kultur, die Philosophie, die Kunst, die Musik von der Aufgabe getrennt haben, die Herrlichkeit Gottes zu preisen, schwingt diese göttliche Bestimmung in ihnen nach. Die Verherrlichung Gottes, die seiner in sich ruhenden Herrlichkeit korrespondiert, alle Kunst, alle Musik zentriert sich um einen Platz, der als Untätigkeit gedacht werden muss – Untätigkeit bis zum Entzug seiner selbst.
2014
Oktober 2014
Albrecht Wellmer, Theodor W. Adorno und der Versuch über Musik und Sprache
Publikation zur Musikphilosophie
Eine zentrale Frage des Versuch über Musik und Sprache ließe sich folgendermaßen zusammenfassen: Wie ist eine Musikästhetik nach Adorno und angesichts der jüngeren Entwicklungen zeitgenössischer Musik möglich? Zur Beantwortung dieser Frage versucht Wellmer gegen alle postmodernen Relativismen einen ästhetisch-normativen Begriff des (musikalischen) Kunstwerks zu verteidigen, ohne diesen dabei der Musik philosophisch aufzuoktroyieren, sondern ihn im Gegenteil aus den Strukturen und Formen spezifischer Werke selbst zu entwickeln. Bereits in diesem »materialorientierten Impuls« deutet sich an, dass die zentralen theoretischen Anknüpfungspunkte von Wellmers Vorhaben die ästhetischen Schriften Adornos sind. So lässt sich das Buch, wie Wellmer im Vorwort betont, als ein Versuch verstehen, »Einsichten Adornos weiterzudenken.«
Mai 2014
Victor Hugo: Die Arbeiter des Meeres
Hörspielproduktion von agoRadio, mit Markus Boysen
»Der Schläfer sieht, mit völlig geschlossenen Augen, aber nicht ohne Bewusstsein, diese seltsamen Tierwesen vorbeihuschen, diese wundersamen Vegetationen, diese furchterregenden oder grinsenden bleigrauen Erscheinungen. Diese Larven, Masken, Fratzen, Hydren, Konfusionen, jenes Mondlicht, ohne Mond, die finsteren Zerfallserscheinungen des Wunderbaren, dieses Werden und Vergehen in verwirrender Dichte, dieses Dahintreiben von Gestalten in der Finsternis, dieses ganze Geheimnis, das wir Traum nennen und das doch nichts anderes ist, als das Nahen einer unsichtbaren Wirklichkeit. Der Traum ist das Aquarium der Nacht. Solchermaßen sinnierte Gilliat ...«
Februar 2014
Röcheln, Rascheln, Räuspern
Vortrag zur Psychopathologie des Konzerthustens
Das dritte und vielleicht plausibelste Erklärungsmodell, das man als sozialpsychologisches oder psychoanalytisches bezeichnen könnte, deutet den Konzerthusten als unbewussten akustischen Protest gegen die strenge soziale Reglementierung, der man in einem Konzert unterworfen ist. Diese Reglementierung beinhaltet zum Beispiel: Ruhigsitzen, Zuhören und Stillsein. (Das Zuhören ist zwar nicht notwendig mit dem Stillsein verbunden aber Stillsein findet seinen Sinn darin, dass zumindest die anderen zuhören können.) Gegen diesen Zwang rebelliert nun das Husten, es kündigt die Verpflichtung zum Stillsein auf und vermasselt den anderen die Möglichkeit zuzuhören.
Januar 2014
Aufruhr und Lärm
Seminar an der HFBK Hamburg, zusammen mit David Wallraf
Seit ihren Anfängen ist die Musik immer wieder in verwickelte Beziehungen mit Bereichen des Politischen eingetreten. Sie wurde im historischen Verlauf sowohl zum Machtinstrument herrschender Ideologien als auch zum Vorboten und Vehikel sozialer Umbrüche und gesellschaftlicher Veränderung. Aus dieser Perspektive betrachtet erscheint Musik als zutiefst gespaltenes Medium: auf der einen Seite dient sie der Repräsentation und Legitimation gesellschaftlicher Herrschaft, auf der anderen Seite ist sie eine von revolutionärem Elan durchdrungene ästhetische Kraft ...
2013
Dezember 2013
Glenn Goulds Fugen
Goulds Entscheidung auf einem derartig tiefen Stuhl zu musizieren ist mit verschiedenen technischen Konsequenzen verbunden: Die tiefe Sitzhöhe ermöglicht eine ganz bestimmte Anschlagtechnik, die besonders gut für eine durchsichtige Darstellung kontrapunktischer Strukturen geeignet ist. Sie versperrt aber auch den Zugang zu einem ›spätromantisch‹ verfassten, virtuosen Repertoire, das allerdings womöglich gar nicht erst aufgesucht werden sollte ...
Oktober 2013
Affekt und Affektion
Vortrag an der HMT Rostock
Wenn in der musiktheoretischen Forschung von ›Affekten‹ die Rede ist, dann wird in der Regel auf die barocke Affektenlehre Bezug genommen und nicht auf zeitgenössische Theorien des Affekts. Das ist etwas verwunderlich, weil aktuelle Überlegungen zum Affektbegriff insbesondere in den sogenannten ›poststrukturalistischen‹ Theorien eine zentrale Rolle spielen, in denen der ›Affekt‹ zum Leitbegriff der Untersuchung ästhetisch-politischer Wissensformationen avanciert ist. Im Gegensatz zu historischen Affektenlehren zeichnet sich die poststrukturalistische Aneignung des Affektbegriffs in ästhetischer Hinsicht durch eine Zurücknahme der Vorstellung von autonomen Subjekten als Produzenten und Adressaten ästhetischer Kommunikation aus. Ihr Fokus liegt eher auf unpersönlichen bzw. ent-subjektivierten Affektartikulationen. Diese zeigen sich weniger als ›Gefühlsregungen‹ eines sich selbst vernehmenden Subjekts, denn als Kräfteverhältnisse und a-subjektive Bewusstseinsströme.
April 2013
Wagners Wege
Seminar an der HFBK Hamburg, Sommersemster 2013
Das musikdramatische Schaffen Richard Wagners bildet bis heute den Ausgangspunkt von polarisierenden künstlerischen Deutungen, kontrovers geführten ästhetischen Diskussionen und diametral entgegengesetzten politischen Positionsbestimmungen. Während die einen Wagners Konzeption des Musik-Theaters kategorisch ablehnen und den Totalitätsanspruch seines ›Gesamtkunstwerks‹ mit protofaschistischen und antisemitischen Intentionen in Ver-bindung bringen, verehren die anderen ihn als größten Revolutionär der Musikgeschichte und Schöpfer einer unvergleichlichen ästhetisch-politischen Utopie.
Juni 2013
Jan Weyand: Wagners Antisemitismus
Gastvortrag im Seminar ›Wagners Wege‹
»Der Prozess der Modernisierung des Antisemitismus seit dem späten 18. Jahrhundert ist ein Prozess der Entwicklung eines Feindbildes, in dem die Juden das Andere von Wir-Gemeinschaften verkörpern. Deshalb wird es nicht nur auf der Ebene der Zugehörigkeit, sondern auch auf der Ebene der Zuschreibungen praktisch unmöglich, von der einen auf die andere Seite zu wechseln. Die Forderung, Juden müssten verschwinden, ist die Konsequenz einer semantischen Entwicklung, in der Juden zum Feind aller Völker werden, das Gegenprinzip von Gemeinschaft verkörpern. […] Wagner ist Teil der Verfertigung eines Wissens, in dem Juden als das radikal Andere des eigenen Selbstbildes konstruiert werden. In diesem Sinne kann man sagen, dass Wagner wie die anderen Antisemiten des 19. Jahrhunderts sicher keine Wegbereiter der Ermordung in dem Sinne waren, dass sie diese vorgedacht oder intendiert hätten. Aber sie waren Teil der Verfertigung einer Wissensformation, die nur einen möglichen Umgang mit Juden zulässt, sie zum Verschwinden zu bringen.« (Jan Weyand)
2012
April 2012
Ästhetik der Empörung?
Seminar an der HFBK Hamburg, Sommersemester 2012
Der Hardcore Punk entstand Ende der 1970er Jahre als Radikalisierung und Weiterentwicklung des Punk Rock. Bis heute hat er sich in verschiedene, teilweise nur noch schwer auf einen gemeinsamen Nenner zu bringende Musikstile und Subgenres aufgespalten. Überblickt man die Vielfalt der verschiedenen Ausprägungen, die sich unter dem Namen ›Hardcore‹ versammeln, so entsteht ein paradoxes Bild: Revolutionäre und progressive politische Absichten scheinen sich mit wertkonservativen und kulturkritischen ›Lifestyles‹ zu überschneiden, subtile und expressive musikalische Gesten reichen sich mit archaischen und stereotypen Ausdrucksformen die Hand. Im Seminar soll – ausgehend von einer groben Nachzeichnung der Grundideen und Entwicklungslinien des Hardcore – die Frage aufgeworfen werden, wie es in ästhetischer Hinsicht gelingen kann, aufrührerische Affekte und wütendes Aufbegehren überzeugend musikalisch in Szene zu setzen.
März 2012
Der leere Platz
Publikation zur (De-)Konstruktion Beethovens
In der Anfangswendung von op. 130 kommt dem ausgelassenen ges eine tragende Rolle zu: Durch sein Fehlen nistet sich der strukturelle Sinn in einer Lücke ein, die jeden Keim‹ bereits im Voraus zu spalten scheint. Das ges verfügt zwar über eine deutlich markierte ›Unhörbarkeit‹ bzw. ein klar gezeichnetes Fehlen. Inwiefern es allerdings als strukturell relevant bezeichnet werden kann, lässt sich in philosophischen Begriffen nur schwer bestimmen. Es ist nicht eindeutig auszumachen, ob sein Fehlen zeichenhaft auf einen ›höheren‹ formalen Sinn verweist oder diesen als verdichtetes Substrat formelhaft zusammenfasst. Auch ist seine Funktion alles andere als klar ...
Februar 2012
Formel und Allegorie
Diplomarbeit im Fach Musiktheorie
Folgt man Christoph Hohlfelds Studie Beethovens Weg, dann stellt Beethoven seinen Kompositionen häufig einen ›offen‹ bleibenden thematischen Ansatz als »Motto« voran, dessen »Einlösungen« sich dann im weiteren Verlauf der Komposition in »proportionaler Weitung […] einstellen.« Die Eingangsthematik fasst in diesem Verständnis die »A priori-Idee der Komposition« verschlüsselt als problematische Struktur zusammen, in der alle späteren Lösungswege bereits »keimhaft« angelegt sind. In diesem Zusammenhang spricht Hohlfeld auch von einer musikalischen »Formel«, womit eine einstimmige Tonfolge gemeint ist, die einen »zündenden« chromatischen Konflikt enthält, der immer wieder in die Thematik »eindringt, die Form durchwirkt als auch übergeordnet das Ganze umspannt« um so teil- und satzübergreifend den »Bau« der Komposition zusammenzuhalten ...